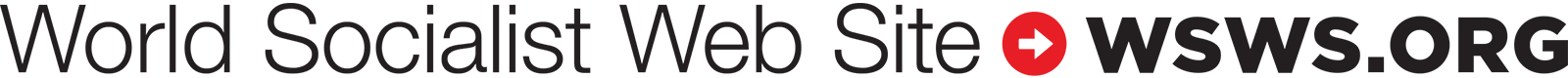Im gegenwärtigen Arbeitskampf der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes versucht sich die Linkspartei einmal mehr als Verteidigerin der arbeitenden Bevölkerung darzustellen. Im Tonfall großer Empörung verurteilen ihre Sprecher in Reden und Pressemitteilungen die geplante Verlängerung der Arbeitszeiten und den daraus resultierenden Stellenabbau. Doch überall dort, wo die Linkspartei selbst an einer Landes- oder Kommunalregierung beteiligt ist, spielt sie seit Jahren eine Vorreiterrolle bei den Angriffen auf Löhne, Arbeitsplätze und die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse.
In einer Erklärung vom 2. Februar bezeichneten die beiden niedersächsischen Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, Dorothée Menzner und Diether Dehm, den Personalabbau im öffentlichen Dienst als "volkswirtschaftlichen Widersinn" und warfen dem Tarifverhandlungsführer der Länder und niedersächsischen Finanzminister Hartmut Möllring (CDU) vor, einen "Konfrontationskurs gegen die Beschäftigten" zu fahren. Sie kritisierten die Pläne der niedersächsischen Landesregierung, 9.000 Arbeitsstellen beim Land abzubauen, und die damit verbundene Mehrarbeit der verbleibenden Beschäftigten, die einer Lohnsenkung von vier Prozent entsprächen.
Die stellvertretende Parteivorsitzende Dagmar Enkelmann bezeichnete in einer Erklärung vom 6. Februar die Forderungen der Beschäftigten nach mehr Einkommen und dem Verzicht auf Arbeitszeitverlängerungen als vollauf gerechtfertigt. Die Erfahrungen der letzten Jahre hätten unmissverständlich gezeigt, dass Lohnverzicht und längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich keine Arbeitsplätze retten könnten. Es dürfe nicht sein, dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes die Zeche für die verfehlte Steuerpolitik der vergangenen Jahre zahlen sollen.
Und Oskar Lafontaine, einer der beiden Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, verurteilte in einer Erklärung vom 3. Februar "vor dem Hintergrund der auf über fünf Millionen angestiegenen Massenarbeitslosigkeit" jeden Versuch, Arbeitszeiten zu verlängern, als unverantwortlich. Die Landesregierungen und kommunalen Arbeitgeberverbände gefährdeten mit ihrer "einseitigen Kostensenkungsideologie" Arbeitsplätze und Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Dienstleistungen. Der Verweis auf die angespannten Länderhaushalte ginge in die Leere, solange die Länder nicht offensiv eine Möglichkeit wie die Wiedererhebung der Vermögenssteuer in Angriff nähmen, so Lafontaine.
Man fühlt sich irgendwie an die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dem Mann mit den beiden widersprechenden Identitäten aus dem englischen Roman von Robert Louis Stevenson erinnert, wenn Lafontaine, Enkelmann und Co. versuchen, der Linkspartei einen soziale Anstrich zu verpassen, während die tagtägliche politische Praxis dieser Partei eine völlig andere Sprache spricht.
In Berlin, wo die Linkspartei seit vier Jahren in einer Koalition mit der SPD die Landesregierung stellt, zeigt sich dieser Widerspruch zwischen Wort und Tat in aller Deutlichkeit. Mehr als einmal hat diese rot-rote Landesregierung eine bundesweite Vorreiterrolle bei den Angriffen auf die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse gespielt. Die unsozialen Maßnahmen, welche die Linkspartei jetzt mit lauten Worten verurteilt, hat sie in Berlin schon vor Jahren selbst durchgesetzt. Genau genommen versuchen die Streikenden in ihren Bundesländern gerade das zu verhindern, was die Linkspartei im Bündnis mit der SPD im Bundesland Berlin bereits den Beschäftigten aufgezwungen hat.
Als im Sommer 2001 das zehnjährige Regierungsbündnis aus SPD und CDU auf Landesebene zerbrach, führte die PDS einen Wahlkampf für mehr soziale Gerechtigkeit und prangerte die kriminellen Machenschaften der Bankgesellschaft Berlin (BGB) an. Doch bereits während der Koalitionsverhandlungen, die der Regierungsübernahme von PDS und SPD im Januar 2002 vorausgingen, gaben beide Parteien bekannt, durch den Abbau von 15.000 Stellen im öffentlichen Dienst verbunden mit längeren Arbeitszeiten und geringerer Bezahlung mehrere hundert Millionen Euro einsparen zu wollen.
Da die geplanten Maßnahmen einen einseitigen Verstoß gegen bestehende Tarifverträge dargestellt hätten, begann die rot-roten Koalition Verhandlungen mit den zuständigen Gewerkschaften über einen so genannten "Solidarpakt". Dadurch sollten Spezialregelungen für Berlin geschaffen werden, um die bestehenden Tarifverträge zu unterlaufen. Konkret forderte der neue Senat eine Anhebung der Arbeitszeit von 39,5 Wochenstunden im Westen auf das Ostniveau von 40 Wochenstunden sowie Gehaltskürzungen in Höhe von 10 Prozent. Unter dem Druck zahlreicher Proteste in der Bevölkerung sahen sich die Gewerkschaften jedoch nicht in der Lage, diesen Forderungen zuzustimmen.
Nachdem die Verhandlungen gescheitert waren, beschloss der Senat im Januar 2003 kurzerhand den Austritt des Landes Berlin aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband. Die geltenden Tarifverträge wurden dadurch für die Beschäftigten des Landes unwirksam und sofort setzte der Senat eine Arbeitszeitverlängerung für Beamte von 40 auf 42 Wochenstunden durch.
Gleichzeitig erpresste er auch die vier Berliner Universitäten und drei der vier Fachhochschulen, die Arbeitgeberverbände zu verlassen, indem er mit der Streichung von Landeszuschüssen drohte. Bei den Verkehrsbetrieben BVG und der städtischen Müllabfuhr BSR setzte er mit derselben Drohung seitdem mehrfach empfindliche Einsparungen durch.
Angesichts des tariflosen Zustands forderte der Berliner Senat die Gewerkschaften ultimativ zum Abschluss eines Sonder-Tarifvertrags auf, war aber zu keinerlei Zugeständnissen bereit. Kurz vor dem erneuten Scheitern der Verhandlungen schaltete sich der Verdi-Vorsitzendem Frank Bsirske persönlich ein und stimmte in einem Spitzengespräch den wesentlichen Forderungen des Senats zu.
Das Ergebnis war ein Tarifvertrag, der den Beschäftigten im öffentlichen Dienst je nach Vergütungsgruppe Lohn- und Gehaltskürzungen zwischen acht und 12 Prozent bescherte, bei einer geringfügigen Verkürzung und Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit. Der, von den Gewerkschaften zu ihrer eigenen Rechtfertigung betonte formelle Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis zum Ende des Jahres 2009 war nichts wert. Der Einstellungsstopp und Arbeitsplatzabbau ging seitdem ungemindert weiter.
So war es der Landesregierung aus Linkspartei (damals PDS) und SPD möglich, bereits im zweiten Jahr ihrer Amtszeit die Personalausgaben des Landes Berlin um satte 262 Millionen Euro zu reduzieren. Wie das Statistische Landesamt in einer Pressemitteilung vom 15. März 2004 feststellte, erfolgte damit zum ersten Mal seit fünf Jahren im Berliner Landeshaushalt eine Absenkung der Personalausgaben. "Diese basiert nicht nur auf der Reduzierung des Personalbestandes, sondern darüber hinaus auf der Kürzung von Bezügen und Gehältern." - so der offizielle Pressetext.
Was den Stellenabbau im öffentlichen Dienst betrifft, so weisen die Statistiken bereits für das Jahr 2004 einen Rückgang der Zahl der im Landesdienst Beschäftigten gegenüber dem Jahr 2002 um 14.779 Stellen nach. Ohne die doppelzüngige Rolle der Linkspartei wären diese Maßnahmen wohl nicht gegen den Widerstand in der Bevölkerung durchzusetzen gewesen.
Als Rechtfertigung für den kompromisslosen Sparkurs der Berliner Landesregierung, musste immer der "angespannte Landeshaushalt" herhalten - also genau das Argument, welches Lafontaine nun so wortgewaltig als "einseitige Kostensenkungsideologie" verurteilt. Dabei ist festzuhalten, dass die leeren Kassen in Berlin maßgeblich von der rot-roten Landesregierung mitverschuldet worden sind.
Als diese die Amtsgeschäfte übernahm, ging sie als Erstes daran, die Finanzierung der Berliner Bankgesellschaft sicherzustellen. Diese war nach dem Wegfall der Bundessubventionen für die Hauptstadt infolge der Wiedervereinigung geschaffen worden, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Mit zahlreichen riskanten Immobiliengeschäften, für die mit Gewinngarantien zahlungskräftige Anleger gewonnen wurden, verdienten sich die Bankvorstände und einige Landespolitiker zwar privat eine goldene Nase, dem Land Berlin aber wurde am Ende die Rechnung in Form einer Überschuldung der landeseigenen Bankgesellschaft in Höhe von vier Milliarden Euro präsentiert.
War es diese Bankenkrise, die überhaupt erst zum Rücktritt der CDU/SPD-Koalition und zu Neuwahlen im Jahre 2001 geführt hatte, so knüpfte der rot-rote Senat direkt nach seiner Machtübernahme an die Politik seiner Vorgängerregierung an. Um die versprochenen Gewinne für die Anleger zu garantieren, versprach der Senat der Bankgesellschaft, bis zum Jahre 2030 sämtliche finanziellen Risiken bis zu einer Höhe von 21,6 Milliarden Euro abzudecken, und richtete einen Sonderposten von jährlich 300 Millionen Euro im Landeshaushalt für Zahlungen an die Bankgesellschaft ein.
Die Vertreter der Linkspartei (damals PDS) und besonders Harald Wolf, der Nachfolger von Gregor Gysi im Amt des Wirtschaftsenators für Berlin, verwiesen dabei immer auf so genannte Sachzwänge und bestehende Verträge, an die der Senat nun einmal gebunden sei. Doch wenn es darum geht, den Landesbediensteten die Löhne und Gehälter empfindlich zu kürzen, ist den Herrn Ministern der Linkspartei jedes Mittel recht, um bestehende Tarifverträge auszuhebeln. Das allein zeigt schon den durch und durch bürgerlichen Charakter dieser Partei. Die Gewinne der reichen Finanzelite werden als unantastbar angesehen, während die Masse der Bevölkerung die Zeche dafür zahlen soll.
Die Doppelrolle der Linkspartei wird immer offensichtlicher. Während sie überall dort, wo sie politischen Einfluss ausübt all die schmerzhaften Maßnahmen gegen die Arbeiterklasse durchsetzt, zu denen die etablierten Parteien sich oftmals nicht mehr in der Lage sehen, versucht sie auf der anderen Seite durch soziale Rhetorik und Demagogie den Widerstand gegen dieselben Angriffe in harmlose Kanäle und namentlich die politische Sackgasse des Sozialreformismus zurückzulenken.