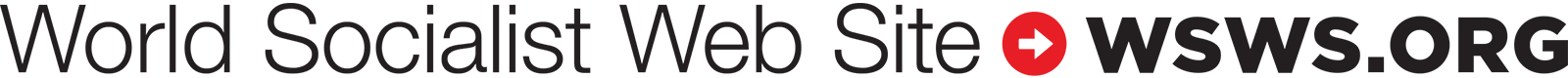Am Sonntag kritisierte die Washington Post, die führende Tageszeitung der US-Hauptstadt, den führenden Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, Barack Obama, für seine "klassenkämpferischen Töne" bei seinen letzten Wahlkampfauftritten.
Die Kolumne der Post beginnt wohlwollend mit den Worten: "Senator Barack Obama ist ganz in seinem Element als Tribun der Hoffnung, als eloquenter politischer Prophet, der die Amerikaner rundheraus daran erinnert, dass wir als Nation gemeinsam groß sein oder fallen werden’." Dann geht sie auf eine Rede ein, die der Senator aus Illinois letzte Woche vor General Motors-Arbeitern in Janesville, Wisconsin, gehalten hat: "Aber dann gibt es Momente, da macht Obama ungewöhnlich böse Bemerkungen, wie letzten Mittwoch in seiner Ansprache, die als bedeutende Erklärung zu seiner Wirtschaftspolitik angekündigt war.
Gewiss, seine typischen Beschwörungen über gerecht verteilte Opfer und gerecht verteilten Wohlstand’ vergaß er nicht. Aber Obamas Botschaft hatte eine zornige und intellektuell törichte Färbung. Wir dachten, wir hätten das Maximum an Klassenkampf und Populismus schon von Ex-Senator John Edwards aus North Carolina gehört, bevor er sich aus dem Rennen zurückzog. In seiner Rede zitierte Obama Edwards zustimmend. Er stimmte ihm zu, dass neue innenpolitische Sozialprogramme durch einen sofortigen Rückzug aus dem Irak finanziert werden könnten, und dass gewisse Handelsabkommen Millionen’ Arbeitsplätze zerstört hätten..."
Vor dem Leitartikel in der Post griff schon ein anderer Artikel die gleiche Rede an. Das war ein Artikel der Wochenendausgabe des Wall Street Journal mit dem Titel "Demokraten verschärfen Angriffe auf die Wirtschaft". Das Journal rügte insbesondere, dass Obama Handelsverträge kritisiert hatte, weil sie "jede Menge Regelungen zum Schutz der Konzerne und ihrer Profite beinhalten, aber keine für unsere Umwelt, und keine für unsere Arbeiter, deren Fabriken schließen und deren Arbeitsplätze millionenfach verschwinden."
Das Journal merkte an: "In Wirtschaftskreise rümpft man die Nase über die Angriffe der Demokraten", und zitierte Randel Johnson, den Vizepräsidenten der US-Handelskammer. "Sie sollten lieber darüber sprechen, wie das Wirtschaftswachstum gefördert werden kann, z.B. durch weniger Regulierung und weniger Belastungen für die Unternehmer, anstatt sie mit primitiver, politisch motivierter Rhetorik zu kritisieren", sagte Johnson.
Obama versucht sich an die weit verbreitete und aufrichtige Stimmung sozialer Unzufriedenheit und politischer Frustration der Wähler anzupassen, verfolgt dabei aber immer seine eigenen Absichten. In seiner Rede in Wisconsin wies er auf die wachsende Kluft zwischen den Reichen und der übrigen amerikanischen Bevölkerung hin und prangerte an, dass viele Unternehmensvorstände am Tag mehr verdienten als der Durchschnittsarbeiter im Jahr. Das Jahrseinkommen einer typischen Familie sei in den letzten sieben Jahren um 1.000 Dollar gesunken.
Dabei stellen Obamas zaghafte Reformvorschläge in keiner Weise das wirtschaftliche Monopol der amerikanischen herrschenden Elite in Frage. Anstatt eine radikale Umverteilung des Reichtums zu fordern, stellt Obama den Familien Steuererleichterungen von ein paar hundert Dollar in Aussicht. Er fordert ein Infrastrukturprogramm von sechs Mrd. Dollar pro Jahr, das ist ungefähr die Summe, die das Pentagon im Irak in drei Tagen verpulvert. Die American Society of Civil Engineers schätzt, dass 1,6 Billionen Dollar vonnöten wären, um Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude wieder in Schuss zu bringen.
Insoweit er aber, wie oberflächlich auch immer, an die gesellschaftliche Unzufriedenheit appelliert, weckt er Erwartungen in der Bevölkerung, die weder er selbst noch irgendein anderer bürgerlicher Politiker erfüllen kann. In hoch gestellten Wirtschafts- und politischen Kreisen geht die Sorge um, dass ein Appell an Klasseninstinkte angesichts der enormen sozialen Spannungen in Amerika, nach dreißig Jahren Ruhe im Klassenkampf, das sprichwörtliche Streichholz sein könnte, dass das Pulverfass zur Explosion bringt.
Bis jetzt haben die Medien Obama beim Kampf um die demokratische Nominierung alle Freiheiten zugebilligt. Der Leitartikel in der Post und der Artikel im Wall Street Journal sind Anzeichen dafür, dass das politische und das Medienestablishment dazu übergehen, ihn an die Kandarre zu nehmen. Falls er ihrem Rat nicht folgen sollte, seine populistische Rhetorik zu zügeln, dann könnten sich die Medien schnell wie ein Mann gegen ihn wenden.
In dem Kampf zwischen Obama und Hillary Clinton werden aber auch wichtige politische und taktische Schattierungen ausgekämpft. Am Tag nach dem Leitartikel in der Post schrieb der New York Times -Kolumnist Roger Cohen einen Kommentar, in dem er Obama gegen Kritik verteidigte und argumentierte, er sei eher als Clinton in der Lage, das internationale Ansehen der Vereinigten Staaten wiederherzustellen, und vertrete so die geopolitischen Interessen der amerikanischen Wirtschaft.
In einer Kolumne mit dem Titel "Ein Realist namens Obama" argumentiert Cohen, die Bush-Regierung habe die US-Alliierten vor den Kopf gestoßen und die Chance vertan, den amerikanischen Einfluss im Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Asien auszuweiten. Gleichzeitig, sagt er, sei Hillary Clinton "zu stark von der Welt der Reichen und Berühmten belastet, in der sich ihr Mann bewegt, die von Kasachstan bis Kolumbien ihre dunklen Geschäfte betreiben". Sie könne die "amerikanischen Erneuerung" kaum glaubwürdig repräsentieren.
Deswegen bestehe, nach den Worten Cohens, "eine realistische Sicht auf Obama darin, in ihm den besten Mann zu sehen, der die neuen Möglichkeiten in der Welt ergreifen und gestalten kann. Er ist noch jung genug, ist weltgewandt, besitzt die Fähigkeit, Menschen mitzureißen, und hat schon bewiesen, dass er Menschen zusammenführen und auch die Spaltung in Schwarz und Weiß überwinden kann".
Cohen sagt, Obama sei nützlich, um Amerika "neu zu erfinden". Das sei entscheidend, um die US-Interessen weltweit zu vertreten. Ein solches "Neu-Erfinden", sagt Cohen, habe selbst die katholische Kirche angewandt, als sie Ende der siebziger Jahre mit Johannes Paul II. einen polnischen Papst auf den Schild hob. Er fügte hinzu. "Und Polen haben dann den Fall des sowjetischen Empires eingeläutet."
Cohen wies das Argument zurück, Obama sei zu unerfahren. Er sagte, seine Regierung würde "über ein entschlossenes außenpolitisches Team verfügen", das in der Lage sein werde, dem Iran und anderen potentiellen Gegnern entgegenzutreten. Gleichzeitig beruhigt Cohen das außenpolitische Establishment mit der Aufforderung an Obama, sich an seine Worte zu erinnern: "Kein Präsident sollte zögern, Gewalt einzusetzen, wenn nötig einseitig, um uns und unsere vitalen Interessen zu verteidigen, wenn wir angegriffen oder unmittelbar bedroht werden."
Cohen macht klar, dass Obamas Befürworter ihn als nützliches Instrument sehen, die Interessen der imperialistischen Politik der USA zu vertreten.
Obama und sein Lager versuchen, den Gegensatz zu verschleiern, der zwischen den Interessen seiner Befürworter in der herrschenden Elite und den Sorgen, Hoffnungen und Erwartungen klafft, die er bei den Wählern mit seinen vagen Aufrufen nach Einheit, Erneuerung und Wandel weckt. Das gleiche gilt für die Signalwirkung, die davon ausgeht, dass er der erste schwarze Amerikaner ist, der eine realistische Chance hat, Präsident zu werden.
Es ist nicht möglich, die innen- und außenpolitischen Interessen der amerikanischen Finanzaristokratie auf einen Nenner mit den Bedürfnissen der großen Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung zu bringen. Die einzige Möglichkeit, den Arbeitern und der Jugend eine anständige Zukunft zu sichern, besteht darin, den ökonomischen und politischen Würgegriff der Wall Street Banken und der großen Konzerne zu brechen.
Sollte er nominiert und gewählt werden, dann besteht kein Zweifel, wessen Hoffnungen und Erwartungen Obama enttäuschen wird. Angesichts der zunehmenden Krise des amerikanischen und des Weltkapitalismus wird die Demokratische Partei - die zweite Partei der amerikanischen Wirtschaft - die Lasten der ökonomischen Katastrophe ohne Zögern der arbeitenden Bevölkerung aufbürden.