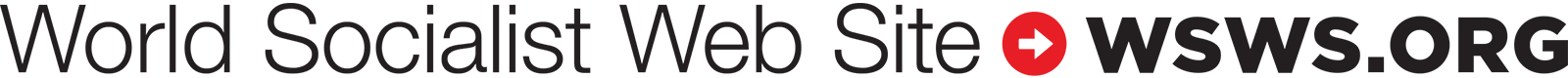In einem Artikel für die Junge Welt vom 3. Januar versucht die Vorsitzende der Linkspartei, Gesine Lötzsch, das politische Erbe Rosa Luxemburgs zur Rechtfertigung der opportunistischen und bürgerlichen Politik ihrer eigenen Partei umzudeuten. Unter der Überschrift „Wege zum Kommunismus“ stellt sie die große Marxistin und Führerin des revolutionären Flügels der Bebel-SPD als Dutzendliberale und Revolutionsgegnerin dar.
Lötzsch will mit ihrem Artikel zwei Dinge erreichen: Zum einen hält sie es offenbar für notwendig, den linken Deckmantel ihrer Partei etwas auszubessern. Zu offensichtlich fungiert die Linkspartei nur noch als Steigbügelhalterin, um der SPD zurück an die Macht zu verhelfen – sei es in Form von rot-roten Regierungskoalitionen wie in Berlin und Brandenburg oder durch die Unterstützung rot-grüner Minderheitsregierungen wie in Nordrhein-Westfalen.
Und zum anderen will sie ihren Co-Vorsitzenden Klaus Ernst aus der Schusslinie nehmen, der parteiintern stark umstritten ist. Ein paar linke Phrasen sollen helfen, die Partei hinter der rechten Politik dieses Gewerkschaftsbürokraten zu einen.
Dabei haben die Zyniker im Karl-Liebknecht-Haus die antikommunistischen Hetztiraden, die die Verwendung des Wortes „Kommunismus“ in einigen Medien auslöste, bewusst einkalkuliert. Nach dem Motto „Viel Feind – viel Ehr“ hoffen Lötzsch und Ernst, die völlige Anpassung an die Politik der SPD leichter durchsetzen zu können, wenn die Partei von außen als „antikapitalistisch“ und „kommunistisch“ bezeichnet wird.
Demselben Zynismus folgt die Bezugnahme auf Rosa Luxemburg. Zwar ist man hinsichtlich der Verfälschung von Luxemburgs politischen Ansichten bereits einiges gewohnt: Nahezu alle angeblich linken Tendenzen in der Linkspartei und um sie herum versuchen, sich mit Luxemburg zu schmücken. Die parteinahe Stiftung der Linkspartei wurde ebenso nach Luxemburg benannt wie eine Konferenz der überregionalen Tageszeitung Junge Welt, zu der einmal jährlich zahlreiche politische Tendenzen in Berlin zum Plausch zusammenfinden. Hinzu kommt der einer DDR-Tradition entstammende jährlich wiederkehrende Marsch von führenden Vertretern der Linkspartei ans Grab von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf dem Lichtenberger Friedhof in Ostberlin, den man nur noch als politische Leichenschändung bezeichnen kann.
Lötzsch setzt mit ihrem Artikel in der Jungen Welt dem ganzen aber die Krone auf. Sie versucht allen Ernstes, die Beteiligung der Linkspartei an bürgerlichen Regierungen und die damit verbundenen scharfen Angriffe auf die Arbeiterklasse in die Tradition von Rosa Luxemburgs konsequent revolutionärer Politik zu stellen. Dieses Unterfangen erfordert freilich eine ganze Reihe dreister Fälschungen von Luxemburgs Positionen. Lötzsch reißt daher Zitate aus dem Zusammenhang, verdreht den Inhalt und verbreitet groteske Unwahrheiten.
Dabei geht sie offenbar davon aus, dass sie für ein Publikum schreibt, das entweder noch nie mit Luxemburgs politischem Erbe in Berührung gekommen ist oder diesen historischen Fragen mit völliger Gleichgültigkeit gegenüber steht. Sie kann sich dabei auf mehrere Vorarbeiten stützen. So hat zum Beispiel die Linkspartei-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung bereits im Jahre 2009 eine pseudowissenschaftliche Textsammlung veröffentlicht, in der sich auf über 150 Seiten verschiedene Anhänger der Linkspartei mit der Aufgabe befassen, in den Schriften Luxemburgs Zitate zu finden, die aus dem Zusammenhang gerissen als Rechtfertigung für ihre eigenen opportunistischen Zwecke verstanden werden können. Aus diesen Arbeiten hat offenbar auch Lötzsch ihre jüngsten Argumente entliehen. Mit ehrlicher wissenschaftlicher Arbeit hat das indes nicht im Entferntesten etwas zu tun.
Bevor sie überhaupt auf Luxemburg zu sprechen kommt, stellt Lötzsch in ihrem Artikel jedes zusammenhängende theoretische und historische Fundament als Grundlage der Partei in Frage. Sie propagiert die vulgärsten Formen des politischen Pragmatismus und bezeichnet die Beteiligung der Linkspartei an bürgerlichen Regierungen als legitimes Experiment auf dem Weg zum Kommunismus:
„Die Wege zum Kommunismus können wir nur finden, wenn wir uns auf den Weg machen und sie ausprobieren, ob in der Opposition oder in der Regierung. Auf jeden Fall wird es nicht den einen Weg geben, sondern sehr viele unterschiedliche, die zum Ziel führen. Viel zu lange stehen wir zusammen an Weggabelungen und streiten über den richtigen Weg, anstatt die verschiedensten Wege auszuprobieren.“
Später greift Lötzsch diesen Gedanken wieder auf und versucht ihn auch Luxemburg zuzuschreiben:
„Sie [Luxemburg] hatte keinen Masterplan und auch keine einfachen Antworten. Sie war auf der Suche, im Dialog mit anderen, zugleich außerordentlich ungeduldig und mahnend, sich nicht hinreißen zu lassen zu Terror und Sektierertum und doch entschieden zu wirken. Sozialismus war für sie kein fertiges Ideal, kein genial entworfener Bauplan, sondern etwas, das aus den realen Kämpfen wachsen würde.“
Damit begibt sich Lötzsch bereits in einen unversöhnlichen Gegensatz zu Luxemburg, die zeitlebens eine konsequente Anhängerin des Marxismus als wissenschaftlich ausgearbeiteter Theorie zur Anleitung der Aktivitäten der Arbeiterklasse und ihrer Vorhut in der revolutionären Partei war. Man kann eine beliebige Schrift von Luxemburg auswählen und wird darin immer deutlich erkennen, dass sie von diesem Grundgedanken ausgehend alle ihre Aktivitäten entwickelt und einer ständigen Überprüfung unterzogen hat. Es sollte daher an dieser Stelle ein kurzer Auszug aus Luxemburgs Schrift zum 20. Todestag Karl Marx’ genügen, um ihre Position klar von derjenigen Lötzschs abzugrenzen:
„Vor allem aber, was gibt uns einen Maßstab bei der Wahl der einzelnen Mittel und Wege im Kampfe, zur Vermeidung des planlosen Experimentierens und kraftvergeudender utopischen Seitensprünge? Die einmal erkannte Richtung des ökonomischen und politischen Prozesses in der heutigen Gesellschaft ist es, an der wir nicht nur unseren Feldzugsplan in seinen großen Linien, sondern auch jedes Detail unseres politischen Strebens messen können.“ [Rosa Luxemburg, Karl Marx, veröffentlicht im Vorwärts (Berlin), Nr. 62 vom 14. März 1903]
Unter der Zwischenüberschrift „Fortschreitende Machteroberung“ erklärt Lötzsch dann, dass die Linkspartei auf Grund der sich verschärfenden Krise des Kapitalismus sehr bald zur Hilfe gerufen werden könnte und für diesen Fall ein Lösungskonzept benötige. Dabei verwehrt sie sich allerdings gleich wieder instinktiv dagegen, dass man mit einer durchdachten Strategie und auf Grundlage einer prinzipiellen Perspektive auf die Krise reagieren könnte:
„Angenommen, der Euro geht als Währung in den nächsten zwei Jahren unter, die Europäische Union zerbricht, die USA kommen nicht aus der Wirtschaftskrise und fallen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in die Hände von radikal-fundamentalistischen Christen. Das Klima verändert sich dramatisch, der Golfstrom kühlt ab, die Flüchtlingsströme überrennen die ‘Festung Europa’, und wir werden gefragt, ob wir für diesen verworrenen Problemhaufen eine Lösung haben. Wer behauptet, dass er für dieses Szenario eine Strategie in der Schublade hat, der ist ein Hochstapler. Was wir anbieten können sollten, ist eine Methode für den Umgang mit solchen Problemhaufen. Wir wissen gar nicht, ob die Mechanismen der Wohlstands- und Verteilungsdemokratie der Bundesrepublik geeignet sind, solche komplexen Aufgaben zu lösen und friedlich abzuarbeiten. Ich habe da meine Zweifel. Die Regierung verbreitet schon jetzt nur noch Kompetenzillusionen. Allerdings sehe ich auch die Linken noch nicht wirklich gut gerüstet, wenn es um die Bewältigung von Gesellschaftskrisen geht.“
Sie fährt fort: „Manchmal – nicht immer – hilft ein Blick in die Geschichte, um sich selbst zu befragen: Wie hättest du unter den gegebenen Bedingungen reagiert? Sind wir heute eigentlich schlauer? Haben wir wirklich aus unseren Fehlern gelernt?“
Mit dieser Fragestellung, die im Falle von Lötzsch und der Linkspartei mit einem klaren „Nein“ zu beantworten wäre, leitet Lötzsch dann zu einer Darstellung der Rolle Luxemburgs nach der Novemberrevolution 1918 über, die wirklich alles auf den Kopf stellt.
Eingerahmt wird diese Darstellung von der Behauptung, dass zum Jahreswechsel 1918/1919 ein sozialistisches Deutschland nicht unmittelbar durchsetzbar und an eine unmittelbare Machtübernahme nicht zu denken gewesen wäre. Diese Erkenntnis habe angeblich Luxemburg dazu gebracht, sich auf Möglichkeiten zu konzentrieren, zumindest bestimmte „Optionen linker Politik“ (Lötzsch) offenzuhalten. Belegt wird diese Behauptung an keiner Stelle. Sehen wir uns an, was Luxemburg selbst dazu in ihrer Rede auf dem Gründungsparteitag der KPD am 31. Dezember 1918 zu sagen hatte:
„70 Jahre der großkapitalistischen Entwicklung haben genügt, um uns so weit zu bringen, dass wir heute Ernst damit machen können, den Kapitalismus aus der Welt zu schaffen. Ja noch mehr. Wir sind heutzutage nicht nur in der Lage, diese Aufgabe zu lösen, sie ist nicht bloß unsere Pflicht gegenüber dem Proletariat, sondern ihre Lösung ist heute überhaupt die einzige Rettung für den Bestand der menschlichen Gesellschaft. [...] Für uns gibt es jetzt kein Minimal- und kein Maximalprogramm; eines und dasselbe ist der Sozialismus; das ist das Minimum, das wir heutzutage durchzusetzen haben.“ [Rosa Luxemburg, Unser Programm und die politische Situation, aus dem Protokoll des Gründungsparteitages der KPD (31. Dezember 1918 – 1. Januar 1919), Berlin 1972, S. 195-222]
Auch lässt Luxemburg in dieser Rede keinen Zweifel daran, dass sie die Revolution für alles andere als abgeschlossen hält:
„Daraus ergibt sich aber, dass wir gerade durch die bisherige Entwicklung, durch die Logik der Ereignisse selbst und durch das Gewaltsame, das über den Ebert-Scheidemann lastet, dazu kommen werden, in der zweiten Phase der Revolution eine viel verschärftere Auseinandersetzung, viel heftigere Klassenkämpfe zu erleben [...], als das vorhin der Fall war; eine viel schärfere Auseinandersetzung [...] deshalb, weil ein neues Feuer, eine neue Flamme immer mehr aus der Tiefe in das Ganze hineingreift, und das sind die wirtschaftlichen Kämpfe. [...] Es liegt gerade in dem ganzen Wesen dieser Revolution, dass die Streiks sich mehr und mehr auswachsen, dass sie immer mehr zum Mittelpunkt, zur Hauptsache der Revolution werden müssen. [...] Das ist dann eine ökonomische Revolution, und damit wird sie eine sozialistische Revolution.“
Keine Spur von einer defensiven Haltung lässt sich bei Luxemburg erkennen. Auch beschäftigt sich Luxemburg an keiner Stelle mit etwas, dass man als „Optionen linker Politik“ bezeichnen könnte. Es ging ihr um nicht weniger als die proletarische Machtergreifung, wie sie im weiteren Verlauf ihrer Rede unzweifelhaft deutlich macht:
„Daraus ergibt sich, was wir zu tun haben, um die Voraussetzungen des Gelingens der Revolution zu sichern, und ich möchte unsere nächsten Aufgaben deshalb dahin zusammenfassen: Wir müssen vor allen Dingen das System der Arbeiter- und Soldatenräte, in der Hauptsache das System der Arbeiterräte in der Zukunft ausbauen, nach allen Richtungen hin. [...] Wir müssen die Macht ergreifen, wir müssen uns die Frage der Machtergreifung vorlegen als die Frage: Was tut, was kann, was soll jeder Arbeiter- und Soldatenrat in ganz Deutschland? [...] Dort liegt die Macht, wir müssen von unten auf den bürgerlichen Staat aushöhlen, indem wir überall die öffentliche Macht, Gesetzgebung und Verwaltung, nicht mehr trennen, sondern vereinigen, in die Hände der Arbeiter- und Soldatenräte bringen.“ [Rosa Luxemburg, Unser Programm und die politische Situation, aus dem Protokoll des Gründungsparteitages der KPD (31. Dezember 1918 – 1. Januar 1919), Berlin 1972, S. 195-222]
Lötzsch kennt diese Haltung Luxemburgs sehr genau, zitiert die doch selbst in ihrem Artikel aus Luxemburgs Rede auf dem Gründungsparteitag der KPD. Dabei widmet sie sich ganz bewusst nur einem Auszug aus dem Absatz, der in Luxemburgs Rede direkt auf den soeben zitierten folgt. Sehen wir uns zunächst an, wie Lötzsch hier Luxemburg zitiert:
„So soll die Machteroberung nicht ein einmalige, sondern eine fortschreitende sein, indem wir uns hineinpressen in den bürgerlichen Staat, bis wir alle Positionen besitzen und sie mit Zähnen und Nägeln verteidigen. Und der ökonomische Kampf, auch er soll nach meiner Auffassung und der Auffassung meiner nächsten Parteifreunde durch die Arbeiterräte geführt werden.“
Würde man nur diesen völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Auszug kennen, man könnte in der Tat zur Auffassung gelangen, Luxemburg habe einer friedlichen Übernahme des kapitalistischen Staates auf ausschließlich parlamentarischem Wege das Wort geredet. Genau dieser Eindruck versucht Lötzsch hier zu erwecken. Bereits im Kontext mit dem bereits von uns zitierten vorhergehenden Absätzen aus Luxemburgs Rede sollte jedoch deutlich geworden sein, dass genau das Gegenteil der Fall ist und Luxemburg hier über die Ersetzung der Institutionen der parlamentarischen Demokratie durch Arbeiter- und Soldatenräte spricht. Das wäre deutlich geworden, hätte Lötzsch den gesamten Absatz und nicht nur einen Ausschnitt daraus zitiert. Der Absatz lautet in seiner Gänze:
„Parteigenossen, das ist ein gewaltiges Feld, das zu beackern ist. Wir müssen vorbereiten von unten auf, den Arbeiter- und Soldatenräten eine solche Macht geben, dass, wenn die Regierung Ebert-Scheidemann oder irgendeine ihr ähnliche gestürzt wird, dies dann nur der Schlussakt ist. So soll die Machteroberung nicht ein einmalige, sondern eine fortschreitende sein, indem wir uns hineinpressen in den bürgerlichen Staat, bis wir alle Positionen besitzen und sie mit Zähnen und Nägeln verteidigen. Und der ökonomische Kampf, auch er soll nach meiner Auffassung und der Auffassung meiner nächsten Parteifreunde durch die Arbeiterräte geführt werden. Auch die Leitung der ökonomischen Auseinandersetzung und die Hinüberleitung dieser Auseinandersetzung in immer größere Bahnen soll in den Händen der Arbeiterräte liegen. Die Arbeiterräte sollen alle Macht im Staate haben. Nach dieser Richtung hin haben wir in der nächsten Zeit zu arbeiten, und daraus ergibt sich auch, wenn wir uns diese Aufgabe stellen, dass wir mit einer kolossalen Verschärfung des Kampfes in der nächsten Zeit zu rechnen haben. Denn hier gilt es, Schritt um Schritt, Brust an Brust zu kämpfen in jedem Staat, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Gemeinde, um alle Machtmittel des Staates, die der Bourgeoisie Stück um Stück entrissen werden müssen, den Arbeiter- und Soldatenräten zu übertragen.“ [Rosa Luxemburg, Unser Programm und die politische Situation, aus dem Protokoll des Gründungsparteitages der KPD (31. Dezember 1918 – 1. Januar 1919), Berlin 1972, S. 195-222]
Doch die bewusste Verfälschung von Luxemburgs Einschätzung der politischen Situation sowie ihren Schlussfolgerungen daraus, bildet für Lötzsch nur die Grundlage für ihren eigentlichen Angriff auf die Perspektive Luxemburgs. So erklärt sie uns in ihrem Artikel unter der Zwischenüberschrift „Revolutionäre Realpolitik“:
„Was hier durch Rosa Luxemburg in der konkreten Situation einer unvollendeten Revolution und der absehbaren Defensive formuliert wurde, ist eine Politik, die sie selbst ‚revolutionäre Realpolitik‘ nannte – ausgehend von den dringenden Nöten der Arbeiter und großer Teile der Bevölkerung soll an Lösungen gearbeitet werden, die deren Lage spürbar verbessern und zugleich zu einer strukturellen Veränderung der Eigentums- und Machtverhältnisse führen. Es sollen Tagesfragen beantwortet und Kapitalismus und Militarismus zurückgedrängt werden mit dem Ziel, diese schließlich zu überwinden. Der Weg dahin sollte vor allem durch das eigene demokratische Handeln der Arbeiter, des Volkes geprägt sein, durch Lernprozesse in der praktischen Veränderung. Es sollte weniger eine Politik für die Arbeiter als durch sie sein. Für mich steht linke Politik insgesamt und die Politik der Partei Die Linke in dieser herausfordernden Tradition gesellschaftsverändernder, radikaler Realpolitik.“
Man möchte ausrufen: Lügen Sie Frau Lötzsch, aber halten Sie Maß! Eine derartig dreiste Umdeutung der großen Revolutionärin Rosa Luxemburg zu einer Befürworterin von Realpolitik verdient eine entschiedene Zurückweisung. Es mag ja sein, dass Frau Lötzsch und ihre Linkspartei es als ihre Aufgabe betrachten, ausschließlich im Rahmen des Kapitalismus auf Tagesfragen zu antworten und dadurch zu versuchen, „strukturelle Veränderung der Eigentums- und Machtverhältnisse“ – wie immer man das auslegen möchte – herbeizuführen. Mit revolutionärer Politik von Schlage einer Rosa Luxemburg hat so etwas aber nicht im Entferntesten etwas zu tun.
Im Gegenteil handelt es sich bei der von Lötzsch geforderten Realpolitik um genau den Opportunismus gegen den Luxemburg zeitlebens mit aller Kraft gekämpft hat und der seinen völlig Bankrott in der Katastrophe der deutschen Sozialdemokratie vom 4. August 1914, als die SPD im Reichstag den Kriegskrediten zustimmte und damit den Ersten Weltkrieg unterstützte, deutlich bewiesen hat. Die Auffassung von Lötzsch ist also keineswegs neu oder originell. Sie wurden am klarsten von Eduard Bernstein in seinem Buch Die Voraussetzungen des Sozialismus dargelegt, auf das Luxemburg mit ihrer berühmten Schrift Sozialreform oder Revolution? bereits in hervorragender Weise geantwortet hat.
Schauen wir uns aber trotzdem noch den Ursprung der Formulierung „revolutionäre Realpolitik“, die bei Lötzsch aus lauter Furcht vor dem Wort „revolutionär“ umgehend zur „radikalen Realpolitik“ entschärft wird, bei Luxemburg an. Während Lötzsch diesen Begriff als eine von Luxemburg selbstgewählte Zusammenfassung ihrer Politik in der Situation nach der Novemberrevolution 1918 darstellt, entstammt er in Wirklichkeit einer Schrift aus dem Jahre 1903 – der Eingangs bereits behandelten Schrift zum 20. Todestag Karl Marx’. Luxemburg schreibt dort unmittelbar im Anschluss an den oben bereits zitierten Abschnitt:
„Dank diesem Leitfaden ist es der Arbeiterklasse zum ersten Mal gelungen, die große Idee des sozialistischen Endziels in die Scheidemünze der Tagespolitik umzuwechseln und die politische Kleinarbeit des Alltages zum ausführenden Werkzeug der großen Idee zu erheben. Es gab vor Marx eine von Arbeitern geführte bürgerliche Politik, und es gab revolutionären Sozialismus. Es gibt erst seit Marx und durch Marx sozialistische Arbeiterpolitik, die zugleich und im vollsten Sinne beider Wörter revolutionäre Realpolitik ist.“ [Rosa Luxemburg, Karl Marx, veröffentlicht im Vorwärts (Berlin), Nr. 62 vom 14. März 1903]
Luxemburg fährt fort, indem sie diese „revolutionäre Realpolitik“ von jeder Art von Realpolitik im herkömmlichen Sinne abgrenzt:
„Wenn wir nämlich als Realpolitik eine Politik erkennen, die sich nur erreichbare Ziele steckt und sie mit wirksamsten Mitteln auf dem kürzesten Wege zu verfolgen weiß, so unterscheidet sich die proletarische Klassenpolitik im Marxschen Geiste darin von der bürgerlichen Politik, dass die bürgerliche Politik vom Standpunkte der materiellen Tagespolitik real, während die sozialistische Politik es von Standpunkte der geschichtlichen Entwicklungstendenz ist. [...] Die proletarische Realpolitik ist aber auch revolutionär, indem sie durch alle ihre Teilbestrebungen in ihrer Gesamtheit über den Rahmen der bestehenden Ordnung, in der sie arbeitet, hinausgeht, indem sie sich bewusst nur als das Vorstadium des Aktes betrachtet, der sich zur Politik des herrschenden und umwälzenden Proletariats machen wird.“ [Rosa Luxemburg, Karl Marx, veröffentlicht im Vorwärts (Berlin), Nr. 62 vom 14. März 1903]
Für Luxemburg ist revolutionäre Politik also deswegen realistisch, weil sie jeden ihrer tagespolitischen Schritte aus der historischen Perspektive der Überwindung des Kapitalismus ableitet. Demgegenüber steht die Realpolitik einer Lötzsch, die nur im dem Sinne realistisch ist, dass sie sich völlig auf dem Rahmen der existierenden Verhältnisse beschränkt.
Um es konkreter zu machen: Würde Luxemburg heute leben und eine realistische Antwort auf die Krise des Kapitalismus formulieren, würde sie zunächst von der Realität ausgehen, dass die Arbeiterklasse keinen einzigen Schritt vorwärts machen kann, ohne die Diktatur der Banken und den Einfluss ihrer Handlanger in den Regierungen, den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie zu brechen. Lötzsch und ihre Linkspartei hingegen gehen von der Realität aus, dass die Diktatur der Banken existiert und man deswegen nur in diesem gesetzten Rahmen operieren könne.
Als wäre das alles der Lüge noch nicht genug, greift Lötzsch am Ende ihres Artikel auch noch einmal die alte stalinistische Verleumdung Luxemburgs auf, die ihr eine prinzipielle Gegnerschaft zum Bolschewismus und zu Lenin und Trotzki als den wichtigsten Führern der Oktoberrevolution andichtet. Lötzsch zitiert dazu aus der Kritik Luxemburgs an der Oktoberrevolution:
„Das Negative, den Abbau, kann man dekretieren, den Aufbau, da Positive, nicht. Neuland. Tausend Probleme. Nur Erfahrung [ist] imstande, zu korrigieren und neue Wege zu eröffnen. Nur ungehemmtes, schäumendes Leben verfällt auf tausend neue Formen...“ [Auslassungen und Hinzufügungen von Lötzsch]
Das ist auch schon alles, was Lötzsch bezüglich dieser Frage von Luxemburg zitiert. Sie hätte ohne Probleme wesentliche schärfere Worte von Luxemburg finden können, die in der Tat heftige Kritik an bestimmten konkreten Maßnahmen der Bolschewiki nach der Machteroberung übte. So unterwarf sie in ihrer Schrift Zur Russischen Revolution, aus der auch das von Lötzsch angeführte Zitat stammt, die Politik der Bolschewiki in der Agrarfrage, die Losung der nationalen Selbstbestimmung und den Verzicht auf die formale Demokratie einer scharfen Kritik. Nur hat diese Kritik nicht im Geringsten ihre prinzipielle Verteidigung der Oktoberrevolution abgeschwächt, was sie auch zum Ende ihrer Schrift in aller Klarheit ausspricht:
„Worauf es ankommt, ist, in der Politik der Bolschewiki das Wesentliche vom Unwesentlichen, den Kern von dem Zufälligen zu unterscheiden. In dieser letzten Periode, in der wir vor entscheidenden Endkämpfen in der ganzen Welt stehen, war und ist das wichtigste Problem des Sozialismus geradezu die brennende Zeitfrage: nicht diese oder jene Detailfrage der Taktik, sondern: die Aktionsfähigkeit des Proletariats, die Tatkraft der Massen, der Wille zur Macht des Sozialismus überhaupt. In dieser Beziehung waren Lenin und Trotzki mit ihren Freunden die ersten, die dem Weltproletariat mit dem Beispiel vorangegangen sind, sie sind bis jetzt immer noch die einzigen, die mit Hutten ausrufen können: Ich hab’s gewagt!“
Luxemburg fährt fort: „Dies ist das Wesentliche und Bleibende der Bolschewiki-Politik. In diesem Sinne bleibt ihnen das unsterbliche geschichtliche Verdienst, mit der Eroberung der politischen Gewalt und der praktischen Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus dem internationalen Proletariat vorangegangen zu sein und die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit in der ganzen Welt mächtig vorangetrieben zu haben. In Russland konnte das Problem nur gestellt werden. Es konnte nicht in Russland gelöst werden. Und in diesem Sinne gehört die Zukunft überall dem ‘Bolschewismus’.“ [Rosa Luxemburg, Zur Russischen Revolution, 1918, zuerst veröffentlicht 1922 von Paul Levi nach dem handschriftlichen Manuskript aus dem Nachlass]
In ihrem Stumpfsinn glauben Lötzsch und die Linkspartei, dass niemand die Schriften von Rosa Luxemburg kennt oder ernsthaft studiert. Denn sonst würde ihr gesamtes Konstrukt aus dreisten Lügen und haarsträubenden Verdrehungen sofort wie ein Kartenhaus in sich zusammen fallen. Wir hingegen rufen jeden dazu auf, den enormen theoretischen Schatz der Werke von Rosa Luxemburg sorgfältig zu studieren, und entsprechende Lehren daraus für die heutige politische Situation zu ziehen.