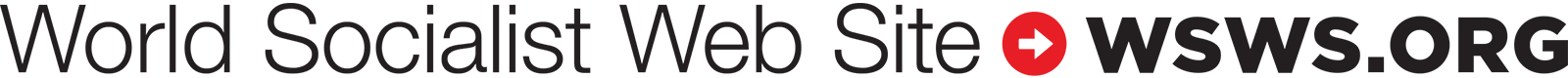100 Tage ist Joachim Gauck nun als Bundespräsident im Amt. Wenn irgendjemand noch geglaubt haben sollte, der frühere Bundespräsident Christian Wulff sei wegen unbezahlter Hotelnächte oder der Annahme anderer „kleiner Geschenke“ von den Medien aus dem Amt gedrängt und durch Gauck ersetzt worden, der dürfte in dieser Zeit rasch eines Besseren belehrt worden sein.
Spätestens die Rede des Bundespräsidenten vor der Führungsakademie der Bundeswehr am 12. Juni machte unmissverständlich klar, für welche Aufgabe Gauck an seinen Platz gestellt wurde. Er soll dazu beitragen gegen jeden Widerstand rasch und energisch eine aggressivere Innen- und Außenpolitik durchzusetzen.
Dem Bundespräsidenten kommen dabei keine großen politischen Entscheidungsbefugnisse zu, aber ganz spezielle ideologische Aufgaben. Gauck packt sie an, energisch und sorgfältig abgestimmt mit der Regierung und ihren Beratern.
Anfang Mai hatte Jan Techau, der Direktor von Canergie Europe, einem rechten Think Tank, in einem bemerkenswerten Kommentar in der Süddeutschen Zeitung (8.5.2012) als Haupthindernis für eine Militarisierung der Außenpolitik den Widerstand in der eigenen Bevölkerung identifiziert. Er schrieb: „Deutschland ist als größtes, stärkstes und geographisch zentrales Land in Europa heute Führungsmacht, ob es will oder nicht. … Doch den Deutschen fällt es schwer, diese Botschaft anzunehmen“, stellt Techau fest und diagnostiziert: „Das Trauma der eigenen Geschichte“ – gemeint ist die Barbarei der zwei Weltkriege und des Hitlerfaschismus – „bleibt wirksam.“
Feiges „Sich-Raushalten“, „Sich-Wegducken“ wie im Fall des Kriegs gegen Libyen sei die Folge, eine Haltung der „vermeintlichen Unschuld aus dem historischen Schuldbewusstsein heraus.“ Deutschland werde seine Rolle nur finden können, wenn es mit sich selbst Frieden macht. „Wir müssen uns selbst vergeben – ohne zu vergessen.“
Techau fordert, sich stärker „materiell und intellektuell“ an der Fortentwicklung der Nato zu beteiligen. Man dürfe nicht länger „kneifen, wenn es um Kampfeinsätze geht.“ Statt „verdruckst, kleinmütig und ängstlich auszuweichen“ müsse Deutschland „in Vergegenwärtigung der Vergangenheit die Verantwortung für die Zukunft annehmen und sie mutig, entscheidungsfreudig und tatkräftig zu tragen.“ Mit diesen Phrasen umschreibt Techau das, was man kurz auch Militarisierung der Außenpolitik nennen kann oder die Rückkehr des Kriegs als Mittel der Politik.
Da jedoch von der Bevölkerung Kriegseinsätze überwiegend immer noch abgelehnt werden, schloss Techau seinen Kommentar in der SZ mit der direkten Aufforderung an Bundespräsident Gauck, sich dieses Problems anzunehmen und dazu beizutragen, das allgemeine „Wegducken“ zu beenden, den Widerstand zu brechen und so „die inneren Voraussetzungen für gute Außenpolitik zu schaffen.“ Techau wörtlich: „Wer, wenn nicht der … Gottesmann Gauck, könnte den Deutschen in einer großen Rede klarmachen, dass sie nur dann in Freiheit und in Frieden mit sich, mit ihren Nachbarn und der Welt leben können, wenn sie den Mut aufbringen, sich selbst zu vergeben.“
Gauck kam dieser Aufforderung umgehend nach und hielt eine „große Rede“ – vor der Bundeswehr. Zum Auftakt schlug er wie so oft antikommunistische Töne an. Als „Opfer der jahrzehntelangen Diktatur“ in der DDR gab er sich jetzt trunken vor Glück, vor der Bundeswehr stehen zu dürfen – vor den Streitkräften, die im Gegensatz zur DDR-Armee NVA eine wirkliche „Armee des Volkes“ sei und dem „Kampf für Frieden und Freiheit“ diene:
„Ich stehe vor der Bundeswehr, zu der ich seit 22 Jahren auch ,meine Armee‘ sagen kann. … Welch ein Glück, dass es gelungen ist, nach all den Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur und nach den Gräueln des Krieges, in diesem Land eine solche Armee zu schaffen: eine Armee des Volkes, im besten, eigentlichen Sinne, kein Staat im Staate, keine Parteienarmee, sondern eine Parlamentsarmee, an demokratische Werte gebunden, an Grundgesetz und Soldatengesetz … Und so ist für mich die Bundeswehr Teil des „Demokratiewunders“, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen vollzogen hat - und vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten dann auch im Osten unseres Landes.“
Dieses „Demokratiewunder“ verdient, genauer betrachtet zu werden: Im Oktober 1950 war der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann, damals noch Mitglied der CDU, vom Amt des Bundesinnenministers im ersten Bundeskabinett Konrad Adenauer wegen dieses „Demokratiewunders“ aus Protest zurückgetreten! Es war bekannt geworden, dass Bundeskanzler Adenauer nicht nur hinter dem Rücken des Kabinetts mit den USA eine militärische Wiederaufrüstung vereinbart und beschlossen, sondern im Mai 1950 bereits praktische Schritte dazu unternommen hatte, nämlich die Gründung der völlig -- auch gegenüber dem Kabinett – geheimen „Zentrale für Heimatdienste“ (ZfH). Unter der Leitung des ehemaligen Wehrmachtsgenerals Gerhard Graf von Schwerin war diese als Abteilung im Bundeskanzleramt ihm persönlich unterstellt. Ihre Aufgabe war, ab sofort zusammen mit vielen ehemaligen Generälen und Offizieren der Wehrmacht systematisch den Aufbau der Bundeswehr vorzubereiten, ohne dass dies – fünf Jahre nach dem Kriegsende! – im Bundestag, geschweige denn durch eine Volksabstimmung, entschieden worden war. [3]
Gustav Heinemann kritisierte dieses Vorgehen scharf und begründete damit seinen Rücktritt: „Der Bundeskanzler denkt in den Formen autoritärer Willensbildung und des stellvertretenden Handelns. … Wenn in irgendeiner Frage der Wille des deutschen Volkes eine Rolle spielen sollte, dann muss es in der Frage der Wiederaufrüstung sein.“ [1]
Der Aufbau der Bundeswehr wurde auch anschließend nie einer demokratischen Entscheidung der Bevölkerung unterworfen, ebenso wenig wie zuvor die Währungsreform, die Gründung des westdeutschen Staates und das Grundgesetz. Alle diese Maßnahmen waren aggressive Initiativen des Westens im Zuge des Kalten Krieges mit dem Ziel, die sowjetisch besetzte Zone und die Sowjetunion selbst wirtschaftlich, politisch und militärisch unter Druck zu setzen und in den Zusammenbruch zu treiben, eine „Neuordnung ganz Osteuropas“ zu erreichen, wie Adenauer es formulierte. Der stalinistischen Bürokratie in Moskau und Ostberlin, die bis 1952 das Ziel verfolgte, ein „neutrales, entwaffnetes Deutschland als Pufferstaat zwischen Ost und West zu errichten, blieb stets nur übrig, darauf zu reagieren.
Auch dafür gibt Gustav Heinemann, als langjähriger ehemaliger Justitiar und Bergwerksdirektor des Rheinstahl-Konzerns „sozialistischer Anwandlungen“ völlig unverdächtig, einen guten Kronzeugen ab. „Ich war damals zu der Überzeugung gekommen“, schrieb er später, „dass die allgemeine politische Entwicklung in höchst gefährlichen Wegen verlief, und zwar vor allen Dingen intoniert von der amerikanischen Seite mit dem Ziel, den Osten unter militärischen und politischen Druck zu setzen.“ [ebd.]
Und noch etwas zu Gaucks „Demokratiewunder“: Wer die Adenauer-Politik der Wiederbewaffnung kritisierte und dagegen demonstrierte, dem drohten bis Mitte der 1960er Jahre hohe Gefängnis- und Geldstrafen. Im Eilverfahren waren im Mai 1951 mit der 1. Strafrechtsänderung die von den Besatzungsmächten abgeschafften Hochverrats- und Landesverrats-Paragraphen wieder ins Strafgesetz eingeführt worden. Auf dieser Grundlage wurden in blindwütiger politischer Justiz nicht nur gegen KPD-Mitglieder und deren Angehörige, sondern auch gegen Mitglieder von Friedensinitiativen, linke Gewerkschafter, christliche Kriegsgegner insgesamt 250.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Schätzungsweise 10.000 Gegner der Adenauer-Regierung wurden oft nur auf Grund ihrer Gesinnung als „Verfassungsfeinde“, „kommunistische Wühlmäuse“ oder „Handlanger Pankows“ (der Ostberliner Regierung) verurteilt, oft zu hohen Zuchthaus,-, Gefängnis- und Geldstrafen [4] – von Richtern, die wie die Offiziere und Generäle der Wehrmacht nahtlos aus dem Dritten Reich übernommen worden waren. Umgekehrt wurde von den rund 3.000 Nazi-Militärrichtern für die 30.000 gegen Kriegsdienstverweigerer und Deserteure vollstreckten Todesurteile kein einziger zur Verantwortung gezogen.
Doch das war nur das Vorspiel der „Großen Rede“. Dem Präludium folgte der Choral. Lang und breit pries Joachim Gauck die Verwandlung der Bundeswehr in eine weltweit tätige Kampftruppe für Kriegseinsätze: „Während wir hier sitzen, stehen Tausende von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auf drei Kontinenten in Einsätzen ihren Mann und ihre Frau. Die Bundeswehr auf dem Balkan, am Hindukusch und vor dem Horn von Afrika, im Einsatz gegen Terror und Piraten - wer hätte so etwas vor zwanzig Jahren für möglich gehalten? Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten, werden heute ausgebildet mit der klaren Perspektive, in solche Einsätze geschickt zu werden - mit allen Gefahren für Leib, Seele und Leben.“
Er beließ es jedoch nicht bei bloßer Kriegspropaganda, sondern verband das Hohe Lied von der Bundeswehr wie gefordert direkt mit dem Angriff auf „das Wegschauen, das Wegducken, das Nicht-Wissen-Wollen der Bevölkerung“, auf die zu geringe Wertschätzung und Präsenz des Militärs und seiner Einsätze „in der Mitte der Gesellschaft“.
„All das darf nicht allein in Führungsstäben und auch nicht allein im Parlament debattiert werden“, betonte Gauck. Es müsse dort debattiert werden, „wo unsere Streitkräfte ihren Ort haben: in der Mitte unserer Gesellschaft.“ Das Staatsoberhaupt fuhr fort: „Wir denken nicht gern daran, dass es heute in unserer Mitte wieder Kriegsversehrte gibt. Menschen, die ihren Einsatz für Deutschland mit ihrer körperlichen oder seelischen Gesundheit bezahlt haben. Und dass es wieder deutsche Gefallene gibt, ist für die Gesellschaft schwer zu ertragen.“
Zur Überwindung der Abwehrhaltung gegen Kriegseinsätze forderte Gauck mehr öffentliche Diskussionen mit Soldaten und Offizieren. Erregt rief er: „Generäle, Offiziere, Bundeswehrsoldaten – zurück in die Mitte unserer Gesellschaft!“ Mehrmals kam er auf diese Forderung zurück und meinte damit wohl, dass Soldaten und Offiziere vermehrt in Talkshows und Feuilletons zu Wort kommen und dort den Ton angeben sollten. Noch gebe es „in unserer Gesellschaft“ zu wenig von der Opferbereitschaft der Bundeswehrsoldaten, zu wenig Todesbereitschaft, stattdessen freue man sich geradezu „glücksüchtig“ des Lebens.
Über das Streben nach Glück äußerte sich Gauck mit tiefer Verachtung: „Dass es wieder deutsche Gefallene gibt, ist für unsere glückssüchtige Gesellschaft schwer zu ertragen… Freiheit ist ohne Verantwortung nicht zu haben. Für Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten, ist diese Haltung selbstverständlich. Ist sie es auch in unserer Gesellschaft? Freiheit und Wohlergehen sehen viele als Bringschuld von Staat und Demokratie. Manche verwechseln Freiheit mit Gedankenlosigkeit, Gleichgültigkeit und Hedonismus [Freude am Leben]. Andere sind sehr gut darin, ihre Rechte wahrzunehmen oder gegebenenfalls auch vehement einzufordern. Und vergessen dabei allzu gern, dass eine funktionierende Demokratie auch Einsatz erfordert, Aufmerksamkeit, Mut und manchmal auch das Äußerste, was ein Mensch geben kann: das Leben, das eigene Leben.“
Diese „Bereitschaft zur Hingabe“ sei selten geworden. Aber, so Gauck: „Hier, in der Bundeswehr, treffe ich auf Menschen mit der Bereitschaft, sich für etwas einzusetzen - gewissermaßen auf 'Mut-Bürger in Uniform'!“
Mit dem Begriff „Mut-Bürger in Uniform“ verkündet Gauck nicht nur den Abschied vom „Staatsbürger in Uniform“, dem Leitbild der Bundeswehrreform seit den 1970er Jahren. Er stellt damit Kampfgeist und Todesbereitschaft des Soldaten auch als Vorbild für alle Bürger ohne Uniform auf, als Gegenbild zu dem laut Gauck verwerflichen Streben nach Wohlergehen und Glück.
Bereits zwei Jahre vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten hatte Joachim Gauck in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Sehnsucht der Bevölkerung nach Glück heftig angegriffen. „Die Leute müssen aus der Hängematte der Glückserwartung durch Genuss und Wohlstand aufstehen!“ verkündete er und antwortete auf die Frage der SZ „Es geht uns zu gut?“: „Es ist die Folge eines Lebens, das nicht mehr jeden Tag von neuem errungen ist. Das ist in Krisenzeiten oder Diktaturzeiten anders“ – heute würde er wahrscheinlich „und auch in Kriegszeiten“ hinzufügen. „Wenn es uns rundum gut geht, ist die Herausforderung nicht so stark, sich definieren zu müssen, … gibt es einen Hunger nach Sinn.“ SZ: „Sind wir zu materialistisch?“ Gauck: „Ehrlich: Ja, das denke ich. Es liegt nicht nur an unserer Zeit – dass die Menschen schnellen Genuss wollen, um sich glücklich zu stellen, gehört zur dunklen Seite der menschlichen Existenz.“
Joachim Gauck knüpft mit diesen Ausführungen direkt an die „Kulturkritik“ bürgerlicher Ideologen und Schriftsteller in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg an, die mit fast identischen Worten die Vorherrschaft des „Materialismus“ in der Gesellschaft, den Verlust von hohen Idealen beklagten bzw. die mangelnde Bereitschaft, für diese zu sterben. Krisen, Armut, Krieg begrüßten sie als „Befreiung von der Dekadenz“, als „läuternde Katastrophe“, „heroische Bewährungsprobe für ein sinnhaftes höheres Sein“ – und lieferten mit diesen Konzepten damals wie heute allen Militaristen die notwendige ideologische Munition.
So schrieb Colmar Freiherr von der Goltz, ein hoher General des Kaiserreichs und brutaler Organisator der Besetzung Belgiens im Ersten Weltkrieg sieben Jahre vor Beginn des Kriegsgemetzels: „Ich wünsche dem deutschen Vaterlande freilich von allen guten Dingen zwei, nämlich völlige Verarmung und einen mehrjährigen harten Krieg. Dann würde sich das deutsche Volk vielleicht noch einmal wieder erheben und für Jahrhunderte vor moralischer Auflösung schützen.“ [5]
Nicht nur mit der Propagierung von Krise, Krieg und Opfertod als „sinngebendes, höheres Sein“, das die „dunkle Seite der menschlichen Existenz“ überwinde, greift Gauck auf die Ideologen des deutschen Imperialismus vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Auch seine Tiraden gegen das „Streben nach Glück“ stehen in dieser Tradition.
Philosophen wie Max Scheler, Soziologen wie Georg Simmel, Wirtschaftswissenschaftler wie Werner Sombart ergingen sich in genau denselben Klagen und beriefen sich dabei auf Friedrich Nietzsche und seine Sentenzen gegen „Materialismus“ und „Hedonismus“. Sie drückten damit ihre erbitterte Feindschaft gegen die wachsende Arbeiterbewegung aus, die mit einem revolutionären sozialistischen Programm für soziale Gleichheit kämpfte und sich nicht damit abfand, dass eine winzig kleine Minderheit an der Spitze der Gesellschaft im Reichtum schwelgte, während die Mehrheit in Armut und Not versank.
Auch Joachim Gaucks Predigten gegen die „Sucht nach Glück und Wohlergehen“ sind gezielt abgefeuerte Attacken eines Vertreters der besitzenden Klasse auf grundlegende soziale und demokratische Rechte der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland und ganz Europa. Den Widerstand der griechischen oder spanischen Arbeiter gegen ihre von Berlin und Brüssel diktierte Verelendung, Proteste gegen Spardiktate zur „Rettung der Banken“, Widerstand gegen Kolonialkriege wie in Afghanistan und Somalia – das ist es, was Gauck als „Glückssucht“ und „Streben nach Wohlbefinden“ geißelt.
In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wird das Streben nach Glück (pursuit of happiness) neben der Freiheit und dem Recht auf Leben zu den unveräußerlichen Rechten aller Menschen gezählt. Für die reiche Finanzelite in Deutschland und ihre politischen und ideologischen Vertreter in Berlin sind diese Rechte nicht mehr hinnehmbar, nicht mehr vereinbar mit ihrer Herrschaft.
Das war die Botschaft der Rede des Bundespräsidenten vor der Bundeswehr.
______________________________________________________________________________
Anmerkungen:
[1] zitiert nach Heinrich Hannover, Die Republik vor Gericht 1954 – 1974.Erinnerungen eines unbequemen Rechtsanwalts; Berlin 1998, 2. Auflage, S. 70]
[2] ebenda
[3] siehe dazu ausführlich Mathias Molt, „Von der Wehrmacht zur Bundeswehr – Kontinuität und Diskontinuität beim Aufbau der deutschen Streitkräfte 1955 – 1966“, Heidelberg, 2007; S.74ff. Da Graf von Schwerin durch eine Indiskretion die Geheimoperation Adenauers an die Presse brachte, wurden er ab- und seine Dienststelle nach nur 6 Monaten aufgelöst und durch das sogenannte „Amt Blank“ ersetzt, das aber dieselben Aufgaben hatte.
[4] siehe Heinrich Hannover zu dem Prozess gegen das „Düsseldorfer Friedenskomitee“ 1959/60, op.cit., S. 57ff.
[5] zitiert nach Wolfram Wette (Hrsg.), Schule der Gewalt. Militarismus in Deutschland 1871-1945. Berlin 2005; S.53