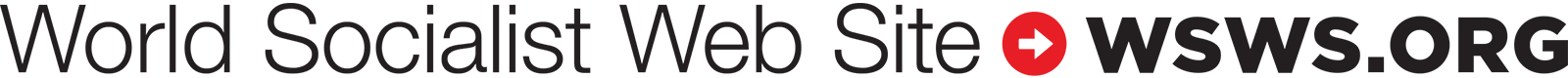Seit der Einigung zwischen SPD, CDU und CSU auf eine Fortsetzung der Großen Koalition in der vergangenen Woche tourt der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert unter dem Motto #NoGroKo durch Deutschland, um innerhalb der SPD-Mitgliedschaft für eine Ablehnung des Koalitionsvertrags zu werben. Sein Auftritt am Dienstagabend in Berlin-Kreuzberg machte deutlich, welche sozialen und politischen Interessen, Befürchtungen und Kalkulationen hinter der Kampagne der Jungsozialisten (Jusos) stehen und auf welche tiefgreifenden gesellschaftlichen Entwicklungen sie reagieren.
Kühnert und den Jusos geht es nicht darum, einen politischen Kampf gegen die Große Koalition zu organisieren, geschweige denn Arbeiter und Jugendliche auf der Grundlage eines sozialistischen Programms für Neuwahlen zu mobilisieren. Ihr Ziel ist es, den Zusammenbruch der SPD in einer Neuauflage der Großen Koalition aufzuhalten und zu verhindern, dass sich die wachsende Opposition in der Bevölkerung außerhalb des offiziellen Parteienspektrums Bahn bricht.
„Vielleicht trage ich da sogar mehr staatspolitische Verantwortung, von der die anderen ansonsten die ganze Zeit reden“, erklärte Kühnert. „Viel mehr Sorgen als um 14, 15 oder 16 Prozent für die SPD“, mache er sich darum, „dass wir mittlerweile eine Situation haben, wo SPD und Union zusammen weniger als 50 Prozent in den Umfrage haben.“ Menschen machten sich „auf die Suche nach tatsächlichen oder eben vermeintlichen Alternativen in unserer Politiklandschaft“, und das verweise „nicht nur auf die AfD“. Dies mache „Politik nicht nur unübersichtlich, sondern gefährlich“.
Gleich zu Beginn seiner Ausführungen auf der Veranstaltung, die mit über 200 Anwesenden für Juso-Verhältnisse gut besucht war, machte Kühnert deutlich, dass er keine grundlegenden Differenzen mit dem Koalitionsvertrag hat, obwohl dieser die Grundlage für die rechteste deutsche Regierung seit dem Untergang der Nazi-Diktatur legt. „Ich glaube unsere Verhandlungsdelegation hat das beste rausgeholt, was unter den gegebenen Umständen möglich war.“ Man könne auch „klar erkennen, dass unsere Partei diejenige war, die mit politischen Zielen überhaupt in diese Verhandlungen hineingegangen ist“.
Eine weitere Zusammenarbeit mit der Union schloss Kühnert ebenfalls nicht aus. „Die Jusos waren nie gegen Gespräche mit der Union“, versicherte er. „Wir haben von vornherein – seit Jamaika im November geplatzt ist – gesagt, wir können gerne mit denen reden, wir können uns über ein Tolerierungsmodell unterhalten.“ Und dieser Zug sei „immer noch nicht abgefahren“. Man könne „ja gerade auf der Basis dieses Papiers [des Koalitionsvertrags] sagen: okay, das wären Themen, die man in Form einer Minderheitsregierung umsetzen könnte“. Er glaube, „dass sich CDU und SPD im Bundestag in Fragen der Europapolitik schnell an vielen Stellen einig werden könnten. Auch aus einem gemeinsamen Verantwortungsgefühl heraus.“
In der Diskussionsrunde sprach sich ein Vertreter der Sozialistischen Gleichheitspartei gegen den rechten Koalitionsvertrag aus und forderte die anwesenden SPD-Mitglieder auf, ihn abzulehnen. An Kühnert richtete er die Frage, inwieweit er als Mitglied des SPD-Vorstands einen Einblick in die geheimen Aufrüstungspläne geben könne und wisse, wie das vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel der Nato – also die Aufstockung des Militärhaushalts um etwa 35 Milliarden Euro bis 2024 – konkret erreicht werden soll?
Die ausweichende Antwort Kühnerts zeigte, dass er gegen die Politik des Militarismus, der inneren Aufrüstung und des Sozialabbaus nicht wirklich etwas einzuwenden hat. „Die Diskussionskultur im SPD-Parteivorstand“ dürfe „man sich leider nicht wie in einem linken Plenum vorstellen“, erklärte er zynisch. Was im Koalitionsvertrag stehe, sei „kein klares Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato“, aber „schon mehr Geld für Rüstung“.
Die vorgesehenen Milliarden seien jedoch „nicht für Aufrüstung“ gedacht, sondern „für Rüstung“. Diese Differenzierung sei ihm wichtig. „Wenn man sich eine Bundeswehr hält, egal ob man die jetzt mag oder nicht“, sei man „auch irgendwo Arbeitgeber“ und müsse sich darum kümmern, „dass die Leute ordentliche Arbeitsbedingungen haben, die sie objektiv im Moment oft nicht haben.“ Aufrüstung sei „was anderes“.
Kühnert mag die Pläne für die massive Erhöhung der Rüstungsausgaben nennen, wie er will, er selbst macht deutlich, dass die Sozialdemokraten die treibende Kraft dahinter sind. Die SPD habe es in diesem Verhandlungsbereich geschafft, in den nächsten Jahren für „eine eins-zu-eins-Kopplung“ bei Rüstung und Entwicklungszusammenarbeit zu sorgen, prahlte er. Das bedeute: „Jeder Euro, der mehr in die Rüstung reingehen wird, wird genau in der gleichen Größenordnung in der Entwicklungszusammenarbeit oben drauf geschlagen.“ Dies sei „ein Erfolg der SPD“ und ein „guter Punkt“.
Kühnerts Plädoyer für das Militärische folgte die Verteidigung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Kürzungen und Polizeistaatsaufrüstung als genuin sozialdemokratische Politik. „Im Kern“ gebe es „eben doch noch keine Abkehr gerade auch von diesem Spar- und Sanktionsregime der letzten Jahre“, gab er zu. Das gelte „übrigens auch für andere Forderungen“ wie der nach „15.000 neuen Polizisten und ähnliches“. Aber man müsse „schon so ehrlich bleiben“ und sagen: „Unser Wahlprogramm war jetzt auch nicht wirklich eine Abkehr von dieser Europapolitik und auch die 15.000 Polizisten waren zugesagt.“ Insofern gelte es den Koalitionsvertrag „bitte nicht an den Stellen [zu] kritisieren, wo unsere Forderungen drin stehen“.
Es spricht Bände über den rechten Charakter der Jusos, dass keines der anwesenden Mitglieder ihren „Kevin“ von links kritisierte. Die Diskussion dreht sich vor allem um die Frage, ob die SPD innerhalb oder außerhalb einer Großen Koalition schneller dem Untergang geweiht sei. Recht früh meldete sich ein älteres SPD-Mitglied zu Wort und stellte fest: „Die SPD ist am Arsch. Wie sieht denn die Alternative aus? Wenn es zu Neuwahlen kommt, können wir bei 12 oder 15 Prozent landen?“ Natürlich sei „eine Große Koalition immer mit Kompromissen beladen“, aber „wenn du nicht dabei bist, dann gestaltest du gar nichts“.
Die Mehrheit der Anwesenden schien zwar gegen die Fortsetzung der Großen Koalition zu sein, aber sprach sich gleichzeitig vehement gegen Neuwahlen aus. Kerstin aus Kreuzberg, die seit 17 Jahren SPD-Mitglied ist, erklärte unter großem Applaus: „Warum lassen wir uns ständig einreden, wenn wir Nein sagen, gibt es Neuwahlen? Ich kann das immer noch nicht glauben.“ Merkel habe „am Sonntag im ZDF gesagt“, sie sei „auch bereit für eine Minderheitsregierung“. Sie habe schließlich genau „so Angst vor Neuwahlen wie wir“. Und auch Steinmeier werde „alles tun, um diese Neuwahlen zu verhindern. Denn keiner will uns im Moment bei 15 Prozent sehen“.
Die anwesenden Neumitglieder waren offensichtlich aus ähnlichen Motiven in die SPD eingetreten. Zwei der vier, die sich zu Wort meldeten, outeten sich als Funktionäre des Berliner Verbands des italienischen Partito Democratico (PD), die auf Grund ihrer Sparpolitik unter Arbeitern und Jugendlichen in Italien ebenfalls zutiefst verhasst ist. Ein anderer sagte, er sei „noch unentschlossen“, wie er beim Mitgliederentscheid stimmen werde. Er glaube aber, „dass Europa und Deutschland eine bessere Politik verdient“ hätten.
Am Ende schwor Kühnert die anwesenden SPD-Mitglieder darauf ein, unabhängig vom Ausgang der Mitgliederbefragung für die „Erneuerung“ der Partei zu kämpfen.
Der Juso-Vorsitzende mag bereits von höheren Parteiämtern träumen, die rechte und arbeiterfeindliche Politik der SPD würde er genauso wenig ändern wie seine Vorgänger an der Spitze der Jusos – darunter der Hartz-IV- und Kriegskanzler Gerhard Schröder und die designierte neue SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. „Mir geht es nicht darum, in Schönheit zu sterben und keine Kompromisse einzugehen“, rief er. Die SPD habe „bewiesen“, dass sie „schwere, schmerzhafte Kompromisse eingehen“ könne. Schließlich habe „keiner so oft in den letzten 20 Jahren regiert wie wir“.