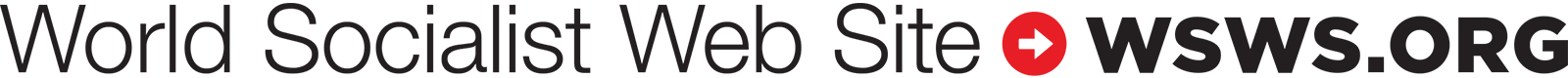Am 9. Oktober hat die Bertelsmann Stiftung eine neue Studie über die Zukunft der Gesetzlichen Krankenversicherungen herausgegeben. Darin prophezeit sie einen drastischen Anstieg des Defizits der Krankenkassen in den nächsten zwanzig Jahren. Als Antwort darauf fordert sie „Kostendämpfung“ und „Anpassungen der überalterten Infrastruktur“. Das sind Euphemismen für weitere drastische Sparmaßnahmen im Gesundheitsbereich auf Kosten der Arbeiterklasse.
Die Studie mit dem Namen „Zukünftige Entwicklung der GKV-Finanzierung“ wurde vom IGES (Infrastruktur und Gesundheit) erstellt, einem privaten Beratungsinstitut für das Gesundheitswesen, das schon früher im Auftrag der Bertelsmann Stiftung tätig war.
Die Autoren der Studie, Dr. Richard Ochmann und Dr. Martin Albrecht, stellen zunächst fest, dass die Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) im letzten Jahrzehnt hohe Überschüsse bilanziert haben. Zurzeit verfügten die Krankenkassen „über im historischen Vergleich hohe Finanzreserven (etwa 20 Milliarden Euro)“, hinzu komme „der Vermögensbestand des Gesundheitsfonds (knapp 10 Milliarden Euro), aufgebaut jeweils aus den hohen Überschüssen der letzten Jahre“.
Allerdings heißt es weiter, dass „spätestens ab Mitte der zwanziger Jahre die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben sich wieder in Richtung Defizit öffnen“ werde. Für das Jahr 2040 müssten die gesetzlichen Krankenkassen und Rentenversicherungen (GKV) mit einem Defizit von 50 Milliarden Euro rechnen. Verantwortlich dafür sei die demographische Entwicklung. Weil die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er- Jahre, die so genannten „Baby-Boomer“, ins Rentenalter einträten, was sinkende Beitragsaufkommen und gleichzeitig höhere Leistungen bedeute, sei „rechtzeitiges Handeln“ gefordert.
Was schlagen die Experten als Lösung vor? Wie sie erklären, müsste der Beitragssatz zu den Krankenkassen schrittweise von derzeit 14,6 Prozent auf 16,9 Prozent im Jahr 2040 erhöht werden, um das Defizit aufzufangen,. Um die Beitragssätze dagegen unter 15 Prozent zu halten, müssten die staatlichen Zuschüsse an die GKV von heute 14,5 Milliarden bis 2040 auf 70 Milliarden Euro ansteigen.
Von beidem raten die Autoren ab. Zwar ist die Bertelsmann-Stiftung nicht generell gegen Beitragserhöhungen. Sie hat schon zum Jahresbeginn vorgeschlagen, den Pflegesatz wegen der Zunahme der Pflegebedürftigen bis im Jahr 2045 von derzeit 3,05 auf 4,25 Prozent anzuheben. Das würde für ein heutiges Durchschnittseinkommen im Jahr fast 550 Euro mehr bedeuten. Die Stiftung ist also keineswegs dagegen, die Auswirkungen der kapitalistischen Krise auf die Arbeiterklasse abzuwälzen.
Allerdings empfiehlt sie in der aktuellen Studie nicht, die Beiträge in naher Zukunft anzuheben. Dahinter steckt die Befürchtung, dass es massiven Widerstand dagegen geben könnte. Und was die höheren Zuschüsse aus Steuermitteln betrifft, so stehen sie im Widerspruch zu den Prioritäten der Bundesregierung, die gerade dabei ist, die Ausgaben für Militär und staatliche Aufrüstung aufzustocken und an den Sozialausgaben zu sparen.
Stattdessen treten die Autoren der Studie für eine „Veränderung der Versorgungsstrukturen“ ein. Diese läuft im Wesentlichen auf Rationalisierungen und Sparmaßnahmen im klinischen Bereich hinaus. Dafür plädiert Uwe Schwenk, Programmdirektor der Bertelsmann-Stiftung, im Vorwort der Studie. Zu den „Maßnahmen der Kostendämpfung“ schreibt er: „Anders als zu Zeiten der Agenda 2010 sollten diese nicht primär bei den Leistungsansprüchen der Versicherten oder der Eigenbeteiligung der Patienten ansetzen. Stattdessen gilt es, die Effizienzreserven in den Strukturen der Versorgung, vor allem im stationären Bereich, zu erschließen.“
Um langfristig Kosten zu sparen, sollen also laut Bertelsmann-Stiftung die Überkapazitäten und „Effizienzreserven“ in den Krankenhäusern und Pflegeheimen abgebaut werden. Dieses Thema ist keineswegs neu: Schon im Sommer hatte die Stiftung die Schließung jeder zweiten Klinik in Deutschland gefordert und in einer Studie von Juli 2019 vorgeschlagen, dass von den heute rund 1400 Krankenhäusern nicht einmal 600 überleben sollen.
Die neue Studie geht in ihren Berechnungen davon aus, dass die Politik auf wichtige Einflussfaktoren, die sich auf die Finanzen der Krankenkassen auswirken, keinen direkten Einfluss ausüben kann. Dazu zählt sie nicht nur die Beschäftigungs- und Lohnentwicklung, sondern auch die Preisentwicklung, welche die Kosten für Gesundheitsleistungen in die Höhe treibt. Damit rechtfertigt sie eine Politik, mit der in den letzten zwanzig Jahren die paritätischen Sozialsysteme zerschlagen und die lukrativeren Teile des Gesundheitssystems der Privatwirtschaft angedient wurden.
Mittlerweile ist der Gesundheitsmarkt ein Milliardengeschäft, von dem nicht nur die Pharmakonzerne, sondern auch die Privatkliniken und Seniorenresidenzen sowie deren Aktionäre an den Börsen profitieren. Doch darüber verliert die IGES-Studie kein Sterbenswort.
Auch die Bertelsmann-Stiftung selbst ist an dieser Bonanza beteiligt. Hinter der Stiftung steht der Bertelsmann-Konzern, dessen zentrale Figur, Liz Mohn, zu den reichsten Frauen der Welt gehört. Sie ist eng mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Springer-Patronin Friede Springer befreundet, und ihre Familie ist auch gut mit den privaten Klinikkonzernen vernetzt.
Ihre Tochter Brigitte Mohn sitzt im Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum AG, einer börsennotierten Betreibergesellschaft, die 54 Krankenhäuser und 35 Medizinische Versorgungszentren betreibt und schon im Jahr 2009 einen Umsatz von 2,32 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Auch führt der Bertelsmann-Konzern eine eigene Krankenkasse, die BKK Bertelsmann, und ist damit an der „Kostendämpfung“ in den Krankenhäusern selbst direkt interessiert.
So geht es in der Studie an keiner Stelle darum, wie eine vernünftige Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung tatsächlich sichergestellt werden kann. Als sei es eine Selbstverständlichkeit, gehen sämtliche Überlegungen davon aus, dass alle Einrichtungen in der Kranken- und Altenpflege kostendeckend arbeiten müssen. Das führt zwangsläufig zu einer Situation, in der die Kliniken bestimmte Patienten abweisen oder notwendige Operationen aus Kostengründen so lange hinausschieben, bis es zu spät ist. Die Folgen hat mittlerweile in der arbeitenden Bevölkerung schon fast jeder am eignen Leib oder an seinen pflegebedürftigen Angehörigen erfahren.
„Höchstes Sterberisiko für Arme und Arbeitslose“
„Wer arm ist, muss früher sterben“ – dieser Slogan wird mehr und mehr zur bitteren Realität. Wer im Alter trotz lebenslanger Arbeit finanziell nicht in der Lage ist, die Mängel im System auf eigene Kosten auszugleichen, kriegt die Auswirkungen dieser Klassenmedizin zu spüren. Das belegt eine aktuelle Studie, die das Rostocker Max-Planck-Institut am 8. Oktober unter dem Titel „Höchstes Sterberisiko für Arme und Arbeitslose“ auf seiner Website angekündigt hat.
Die Rostocker Autoren haben einen staatlichen Datensatz der Deutschen Rentenversicherung ausgewertet, der mehrere Millionen Versicherte umfasst. Auf dieser Grundlage untersuchten sie, wie Armut, Arbeitslosigkeit und mangelnde Bildung sich auf die Sterblichkeit auswirken. Wie sie feststellten, verdoppelt Arbeitslosigkeit das Sterberisiko, und ein geringes Einkommen wirkt sich geradezu verheerend aus: „Die Sterblichkeit des am schlechtesten verdienenden Fünftels lag um 150 Prozent über dem des am besten verdienenden Fünftels.“ Von dieser Ungleichheit sind besonders Männer in Ostdeutschland betroffen – allein aufgrund der Tatsache, dass es dort „einen höheren Anteil an Arbeitslosen, an weniger Gebildeten und an Menschen mit geringerem Einkommen“ gibt.
Die Bertelsmann-„Experten“ dagegen empfehlen, gerade die armen Alten, eine besonders hilflose Bevölkerungsgruppe, zu Sündenböcken zu machen.
15,6 Prozent der Rentner sind arm, d.h., sie haben ein Einkommen, das unter 917 Euro monatlich liegt. In dieser Gruppe ist die Angst vor dem sozialen Absturz besonders groß, denn die Quote der Altersarmen wächst stärker als die Armutsquote in jeder anderen Bevölkerungsgruppe. In Westdeutschland trifft es besonders Frauen, die jahrelang ohne Bezahlung Kinder aufgezogen haben. Bundesweit sind auch die Langzeitarbeitslosen stark betroffen. Armutsgefährdet im Alter ist jeder, der heute weniger als 13 Euro in der Stunde verdient. Auf sie alle zielt die Studie ab, wenn sie fordert, „die überalterten Versorgungsstrukturen anzupassen“.
Die Deregulierung und Privatisierung von Sozialsystemen wurde in Deutschland durch die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder (SPD) und Joschka Fischer (Grüne) eingeleitet. Die Bertelsmann-Stiftung begleitete deren Agenda 2010 und Hartz IV von Anfang an. Die 1977 gegründete Stiftung, die in ihren Gründerjahren offiziell noch das Konzept der „Sozialen Marktwirtschaft“ hochhielt, wurde in den 1990er Jahren ideologischer Stichwortgeber der neoliberalen Wende.
Schon 1993 gab sie im Zuge der Globalisierung die Broschüre „Weiterentwicklung und Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft“ heraus. Darin rechtfertigte Rüdiger Soltwedel die staatliche Umverteilung von unten nach oben und griff „mächtige Interessengruppen“ an. Damit meinte er damals vor allem die Gewerkschaften, die aber die Umverteilung mittrugen und unterstützten.
Soltwedel schrieb: „In der Sozialen Marktwirtschaft ist der Staat also nicht lediglich ein ‚Nachtwächter‘. Es bedarf im Gegenteil sogar eines starken Staates, der sich im Interesse der gesamten Volkswirtschaft dem Drängen der vielfältigen und mächtigen Interessengruppen erwehren kann. Andernfalls besteht die permanente Gefahr, dass die marktwirtschaftliche Effizienz überfrachtet wird durch staatliche Umverteilung, Regulierung und Subvention.“ (Gütersloh 1995, S. 24).
Die neue Bertelsmann-Studie zeigt unzweideutig, dass die Vertreter der „Sozialen Marktwirtschaft“ nicht mehr in der Lage sind, für das sorgenfreie Alter breiter Bevölkerungsschichten zu sorgen, und dass sie abgewirtschaftet haben. Die kapitalistische Gesellschaft kann ihre Alten nicht mehr versorgen und hat mit ihrer ganzen Klientel ihre Daseinsberechtigung verspielt.