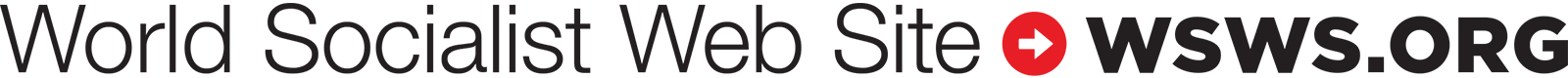Oskar Lafontaine hat zum zweiten Mal in seinem Leben eine Partei verlassen, die er selbst mit aufgebaut und geführt hat. Am 17. März erklärte der 78-Jährige seinen Austritt aus der Linkspartei.
Vor 23 Jahren war Lafontaine vom Bundesvorsitz der SPD zurückgetreten, in der er zuvor 40 Jahre lang aktiv gewesen war. Auch das Amt des Bundesfinanzministers und sein Bundestagsmandat legte er damals von einem Tag auf den anderen nieder. 2007 gründete er dann gemeinsam mit Gregor Gysi die Linkspartei, an deren Spitze er drei Jahre lang stand. Zuletzt war er Vorsitzender der heillos zerstrittenen Landtagsfraktion der Linken im Saarland, wo ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn lief.
In einer kurzen Erklärung begründete Lafontaine seinen Austritt mit den Worten: „Ich habe einst die SPD verlassen, weil sie zu einer Partei geworden war, die im Gegensatz zur Tradition der Sozialdemokratie Willy Brandts Niedriglöhne förderte, Renten und soziale Leistungen kürzte und die Beteiligung der Bundeswehr an völkerrechtswidrigen Kriegen unterstützte. Ich wollte, dass es im politischen Spektrum eine linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit und Ungleichheit gibt, deshalb habe ich die Partei Die Linke mitgegründet. Die heutige Linke hat diesen Anspruch aufgegeben.“
Wen will Lafontaine damit täuschen?
Als Die Linke 2007 gegründet wurde, war längst klar, dass sie keine „linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit und Ungleichheit“ ist. In Berlin saß die PDS, die den Großteil der Mitglieder der neuen Partei stellte, seit fünf Jahren im Senat und verantwortete ein bundesweit einzigartiges Kahlschlagprogramm. In anderen östlichen Bundesländern und Kommunen spielte die PDS eine ähnliche Rolle. Sie hatte sich längst als verlässliche Stütze der kapitalistischen Ordnung erwiesen.
Die WASG, die sich mit der PDS zur Linkspartei zusammenschloss, bestand aus abgehalfterten Sozialdemokraten und Gewerkschaftern, die die arbeiterfeindliche Politik der SPD jahrelang mitgetragen hatten und nun panisch fürchteten, dass die verheerenden sozialen Folgen der Agenda 2010 der Regierung Schröder zum Untergang der SPD und zur Wiederbelebung des Klassenkampfs führen. Dem sollte die Linke vorbeugen.
Dieses Projekt ist kläglich gescheitert. Der Rücktritt Lafontaines erfolgt nicht zufällig zu einem Zeitpunkt, an dem die Folgen der Coronapandemie und des Ukrainekriegs weltweit offene Klassenkämpfe auf die Tagesordnung setzen. Die Illusion, dass es eine Rückkehr zur Politik Willy Brandts gebe, der Anfang der 1970er eine militante Welle von Arbeitskämpfen und Jugendprotesten durch soziale Zugeständnisse auffing, ist restlos geplatzt.
Der Kapitalismus kennt nur noch eine Richtung: immer schärfere Angriffe auf die Arbeiterklasse. Damit die Profite weiter fließen und die gewaltige Spekulationsblase nicht platzt, müssen die Löhne gesenkt, die Arbeitshetze gesteigert und Arbeitsplätze vernichtet werden. Der Krieg in der Ukraine, ein Stellvertreterkrieg zwischen Nato und Russland, leitet eine neue Runde imperialistischer Kämpfe um die Neuaufteilung der Welt ein.
100 Milliarden Euro werden zusätzlich in die Rüstung gesteckt, aber für Bildung, Gesundheit und andere dringende gesellschaftliche Bedürfnisse ist kein Cent da. In Berlin, wo Die Linke mitregiert, streicht der Senat den Schulen gerade die letzten frei verfügbaren Gelder.
Die Linke zerbricht unter dem Druck dieser Widersprüche. Während die Regierungs-Linken – Ramelow, Kipping, Bartsch, Gysi & Co. –mit dem Staatsapparat verschmelzen und offen die Kriegspolitik der Nato unterstützen, gleiten andere ins rechtsextreme Lager ab. Lafontaine und seine Frau Sahra Wagenknecht machen seit langem durch ausländerfeindliche Tiraden, Solidarität mit Impfgegnern und völkisch-nationalistische Hetze auf sich aufmerksam.
Die Behauptung, Lafontaine sei ein „Linker“, war schon immer falsch. Erzogen in einem bischöflichen Konvikt in der Eifel, stand er der katholischen Soziallehre weit näher als der marxistischen Lehre vom Klassenkampf. Seine Sozialpolitik verfolgte immer das Ziel, den Klassenkampf zu unterdrücken, nicht die Arbeiterklasse zu stärken. Sie ging einher mit einer Politik des starken Staats und einem abstoßenden Nationalismus.
So führte Lafontaine in den 1970er Jahren als Oberbürgermeister von Saarbrücken als Erster Zwangsarbeit für jugendliche Sozialhilfeempfänger ein. Als Ministerpräsident des Saarlands wickelte er dann den Bergbau und die Stahlindustrie des Landes ab. Zwischen 1960 und 2005 wurden dort vier Fünftel der knapp 100.000 Arbeitsplätze vernichtet. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und soziale Abfederungsmaßnahmen gelang es Lafontaine, den heftigen Widerstand der Arbeiter dagegen zu brechen.
Schon damals verband Lafontaine den Sozialabbau mit heftigen Angriffen auf Flüchtlinge und Migranten, die er im Jargon von Rechtsextremen als „Fremdarbeiter“ bezeichnete. Im Jahr 1993 sorgte er dafür, dass die SPD der faktischen Abschaffung des Asylrechts zustimmte.
Der Grund für Lafontaines Bruch mit der SPD 1999 war die Furcht, die Agenda 2010 von Bundeskanzler Schröder werde die Fähigkeit der SPD untergraben, den Klassenkampf zu kontrollieren.
Wir stellten damals die Frage: „Weshalb hat Lafontaine kampflos kapituliert und nicht den geringsten Versuch unternommen, seine Auffassungen zu verteidigen und Unterstützung dafür zu gewinnen?“ Die Antwort war klar: „Hätte Lafontaine der Wirtschaftslobby, die der Regierung immer unverschämter ihre Bedingungen diktiert, die Stirn geboten, … hätte er gesellschaftliche Kräfte auf den Plan gerufen, die er auf keinen Fall wecken will.“
Nach dem Bruch mit der SPD trug Lafontaine seine autoritären und nationalistischen Auffassungen immer offener zur Schau.
Zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 schrieb er: „Offene Gesellschaften brauchen einen starken Staat. Deregulierung, Privatisierung, Green Card für Techniker, Pilotenscheine für ein paar Dollar, Niederlassungsfreiheit für jedermann und leere Staatskassen untergraben innere und äußere Sicherheit. Die Verächtlichmachung des Staates muss ein Ende haben.“
Lafontaines „Pazifismus“, der bis zu den Demonstrationen gegen die Stationierung US-amerikanischer Pershing-II-Raketen Anfang der 1980er Jahre zurückgeht, richtet sich nur gegen die USA. Geht es dagegen um deutsche Interessen, ist Lafontaine Militarist.
So schrieb er 2017, als die Trump-Administration Sanktionen gegen Russland verhängte: „Es ist an der Zeit, dass Europa seine eigenen Interessen wahrnimmt und die mehr oder weniger bedingungslose Gefolgschaft gegenüber den USA aufgibt.“ Leider sei die Linke „die einzige Partei, die nicht im Fahrwasser der Hörigkeit gegenüber der einzig verbliebenen Weltmacht schwimmt“. Nur „eine starke Linke könnte im Bundestag gegenüber jeder denkbaren Koalition der neoliberalen Parteien … immer wieder darauf drängen, dass die eigenen Interessen von Deutschland und Europa stärker vertreten werden als die ‚unlauteren’ Ziele der US-Politik.“
In der Flüchtlingspolitik vertrat Lafontaine spätestens seit 2015 dieselben Standpunkte wie die AfD. Im Herbst 2020 stellte er in München sogar ein neues Buch des rassistischen Hetzers Thilo Sarrazin vor.
Die Sozialistische Gleichheitspartei vertrat seit deren Gründung den Standpunkt, dass die PDS und Die Linke pro-kapitalistische Parteien sind und dass eine sozialistische Opposition nur im politischen Kampf gegen sie aufgebaut werden kann. Pseudolinke Organisationen wie Marx21 und SAV haben sich dagegen in der Linkspartei eingenistet, weil sie selbst Gegner einer sozialistischen Perspektive sind.