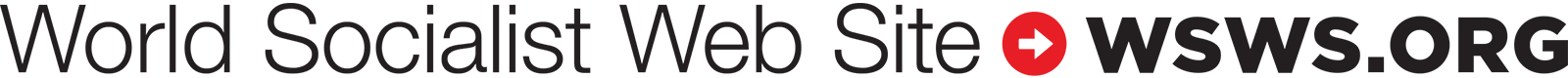US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch per Dekret einen Zoll von 25 Prozent auf alle Importe von Autos aus ausländischer Produktion in die USA verhängt und damit seinen Handelskrieg erneut deutlich verschärft.
Die Zölle werden am 2. April in Kraft treten. Am gleichen Tag will Trump auch seine Pläne für „reziproke Zölle“ vorstellen, die vermutlich für zahlreiche Länder weitere Zölle bedeuten statt, wie bisher, nur gegen bestimmte Waren.
Trump unterzeichnete das Dekret zur Einführung der Autozölle bei einer Pressekonferenz im Oval Office und erklärte, der nächste Mittwoch werde „in Amerika zum Tag der Befreiung werden. ... Wenn die Autos in den Vereinigten Staaten gebaut werden, wird es keinen Zoll geben.“
In den letzten Tagen gab es beträchtliche Verwirrung über die Frage, ob Autos, die in Mexiko und Kanada zusammengebaut wurden, aufgrund des Freihandelsabkommens mit den USA von den Zöllen ausgenommen würden. Trump schloss dies bei seiner Pressekonferenz aber offenbar aus.
Er erklärte: „Wir werden einen 25-prozentigen Zoll auf alle Autos einführen, die nicht in den USA gebaut wurden. ... Größtenteils wird das dazu führen, dass Autos an einem Ort hergestellt werden.“
Neben Kanada und Mexiko werden auch zahlreiche weitere Länder von dem neuen Dekret betroffen sein, vor allem Japan und Südkorea.
Laut brancheninternen Schätzungen würde ein Zoll von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada zu Mehrkosten in Höhe von 6.000 Dollar führen. Der Branchendienst Cox Automotive erklärte, die Zölle würden schnell zu einem starken Abschwung der Industrie führen. Trump hingegen behauptet, sie würden ein neues goldenes Zeitalter der amerikanischen Autoindustrie einläuten.
Der Chefökonom von Cox Automotive Jonathan Smoke erklärte gegenüber dem Wall Street Journal: „Kurz gesagt: sie werden zu geringerer Produktion, schlechterer Versorgungslage und höheren Preisen führen.“
Trumps erklärtes Ziel, die Autoproduktion vollständig an einem Standort zu konzentrieren, ist völlig unvereinbar mit dem komplexen Produktionsnetzwerk, das sich in den letzten vier Jahrzehnten entwickelt hat. Es lässt sich heute unmöglich feststellen, ob ein Auto in den USA oder im Ausland gebaut wurde.
Die New York Times nannte in einem Artikel einige Beispiele für diese Absurdität, darunter einen Chevrolet-SUV, der in Mexiko montiert wird, dessen Motor und Getriebe aber in den USA hergestellt wurden. Dieser würde als „im Ausland produziertes Auto“ gelten.
Der Nissan Altima wird in Tennessee und Mississippi montiert und gilt daher vermutlich als „in Amerika produziert.“ Allerdings kommen sein Zwei-Liter-Motor aus Japan und das Getriebe aus Kanada. Der Toyota RAV-4 wird aus Kanada importiert, aber 70 Prozent seiner Komponenten werden in den USA hergestellt. Die Liste lässt sich noch weiter fortsetzen.
Vor etwa 90 Jahren, als sich angesichts der eskalierenden Handelskriege der nächste Weltkrieg anbahnte, wies Trotzki darauf hin, dass Zölle und nationalistische Politik vom wirtschaftlichen Standpunkt aus zwar völlig irrational sind, aber eine unerbittliche Logik bei der Kriegsproduktion spielten: durch sie sollten die nationalen Produktivkräfte für eine Kriegswirtschaft konzentriert werden. Heute ist die gleiche Logik erneut am Werk.
Die Zölle werden nicht nur die Produktionsnetzwerke der Autoindustrie in den USA, Kanada und Mexiko zerstören, sondern auch Japan als einen der weltweit größten Autoexporteure schwer treffen. Toyota, das stark in die Produktion in Nordamerika investiert hat, ist ebenso gefährdet wie Honda, Nissan, Mazda und Subaru.
Laut einem Bericht der Times hat Toyota eine Million der 2,3 Millionen Autos, die es letztes Jahr in den USA verkauft hat, außerhalb der USA gebaut. Die Vorstände von Toyota, Nissan und Honda haben vor schwerwiegenden Umsatzrückgängen gewarnt. Auch südkoreanische Autokonzerne, die bereits jetzt einen Abschwung verzeichnen, werden die Folgen stark zu spüren bekommen.
Autos sind Japans wichtigster Exportartikel, und laut Berechnungen des Finanzunternehmens Nomura werden die Auswirkungen der Zölle so groß sein, dass das BIP um etwa 0,2 Prozent schrumpfen wird. Da Japan für dieses Jahr nur mit einem Wachstum des BIP von 0,5 Prozent rechnet, entspricht das einer Verringerung von 40 Prozent.
Die Autoexporte aus Europa, insbesondere aus Deutschland, werden einen schweren Schlag erleiden, da die Europäische Union ein Hauptziel in Trumps allumfassendem „Krieg der reziproken Zölle“ sein wird, der am kommenden Mittwoch angekündigt werden soll.
Bei der Pressekonferenz zu den Autozöllen drohte Trump außerdem mit Zöllen auf Holz und „reziproken Zöllen“ für „alle Länder“ statt nur für die so genannten „schmutzigen Fünfzehn“, d.h. die großen Exporteure in die USA, die Finanzminister Scott Bessent nannte.
Eines der wichtigsten Ziele ist die Europäische Union, die laut Trump „die USA bescheißen“ will.
Am Dienstag verbrachte der oberste Handelsunterhändler der EU, Maroš Šefčovič, einen Tag in Washington und versuchte, in letzter Minute einen Aufschub zu erreichen. Er traf sich mit Handelsminister Howard Lutnick, dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Kevin Hassett, dem Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats. Er blieb erfolglos.
Laut einem Bericht in der Financial Times erklärten „Vertreter der EU, die US-Seite sei nicht von ihrer Entschlossenheit zur Einführung der Zölle abgerückt und habe sich bei den Treffen unablässig über die Handelspolitik der EU beklagt.“
Sie hätten ohnehin keine konkreten Angebote unterbreiten können, da die endgültigen Entscheidungen bei Trump liegen.
Laut der Financial Times erklärte der EU-Handelskommissar, er habe mit Zöllen „im Bereich von 20 Prozent“ gerechnet, die für den Handelsblock jedoch bereits „verheerend“ wären.
Da Šefčovič erkannte, dass China das Hauptziel des Trump-Regimes ist, versuchte er sogar, an dessen anti-chinesische Haltung zu appellieren. Doch auch sein Versuch, die US-Regierungsvertreter zu überzeugen, dass beide Seiten ein Interesse an der Verteidigung der Märkte gegen chinesische Importe haben, blieb erfolglos.
Die EU hat eine Reihe von Gegenmaßnahmen für die Ankündigungen am 2. April vorbereitet. Diese kommen zu den Maßnahmen im Wert von 26 Mrd. EUR hinzu, die sich gegen US-Exporte infolge der 25-prozentigen Abgabe auf Stahl und Aluminium richten und am 12. April in Kraft treten sollen.
Vertreter der EU erklärten, die USA würden ihre Politik nicht ändern und die Rechtfertigung für die Zölle sei nicht klar.
Denn es sei noch zu klären, mit welchem juristischen Mittel Washington sie durchsetzen wird. Da sich die Trump-Regierung jedoch offen zu ihrer Gesetzlosigkeit bekennt, wird dies kein Hindernis sein.